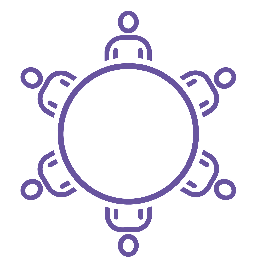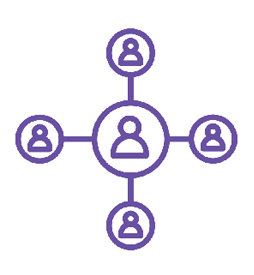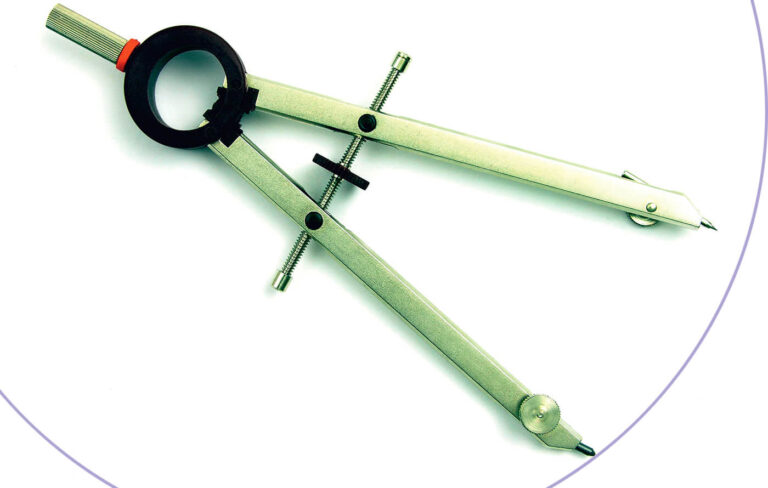Dr. Stefanie Weidner ist Vorständin der Werner Sobek AG. In ihrem Gastbeitrag appelliert sie an die junge Generation der Bauingenieure, sich für Nachhaltigkeit stark zu machen.
Zur Person
Stefanie Weidner ist promovierte Architektin mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeitsstrategien. Seit Sommer 2024 ist sie Vorständin der Werner Sobek AG. Vorher leitete sie bereits das Kopenhagener Büro des Unternehmens. Sie ist außerdem DGNB Consultant und ehrenamtliche Beirätin des Start-up-Unternehmens Optocycle.
Endlich, nach jahrelanger Vorbereitung: Der Einstieg ins Berufsleben und die ersten eigenen Projekte. Eine aufregende und spannende Zeit. Oft aber auch eine Zeit der ersten Krisen, der Fragen nach dem Sinn. Ist das, was ich da im Beruf mache, eigentlich das, worauf ich mich all die vergangenen Jahre vorbereitet habe? Wieso ist das alles so kompliziert – und wieso sind meine Projekte nicht so nachhaltig, wie ich mir das immer vorgestellt habe? Hinzu kommen die negativen Schlagzeilen, denen wir permanent begegnen: explodierende Materialpreise, abrupt steigende Zinsen, insolvente Projektentwickler, immer komplexere Regularien und Vorschriften. Entwicklungen, die der Lust auf eine Tätigkeit im Bauwesen einen empfindlichen Dämpfer verpassen können. Deshalb hier fünf Gründe, warum es sich lohnt durchzuhalten. Denn: Wer sich intensiver mit der Nachhaltigkeit in der gebauten Umwelt beschäftigt, der merkt schnell, dass dieser Bereich vorrangig von den Jüngeren vorangetrieben wird.
1) Nicht zu bauen ist auch keine Lösung
Immer wieder hört man den Ruf nach einem Stopp jeglicher Neubauprojekte. Für einige Regionen und Gebäudetypologien (Stichwort: Einfamilienhäuser und monofunktionale Kaufhäuser …) mag dies der richtige Ansatz sein, verallgemeinern lässt sich eine solche Forderung aber sicher nicht. Die Ballungsräume erfahren einen steten Bevölkerungszuwachs. Das bedeutet, dass nicht nur zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden muss (aktuell fehlen je nach Schätzung bis zu 1.000.000 Wohnungen), sondern auch mehr Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, mehr Nahversorgung, mehr Infrastruktur etc. Hierfür brauchen wir neue Lösungen und Konzepte, mehr (Nach-)Verdichtung, Möglichkeiten zur Aufstockung, Sharing- Modelle und Strategien für ein inklusives, gesundes Leben auf begrenzter Fläche. Hierauf müssen wir Planenden uns einstellen – sei es bei Neubauten, Bestandssanierungen oder manches Mal auch durch die Empfehlung, gar nicht zu bauen. Egal, in welche Richtung es geht: Unsere Expertise ist gefragt! Übrigens: Global gesehen ist der Bedarf an gebauter Umwelt noch viel größer, müssen doch in den kommenden Jahren über zwei Milliarden zusätzliche Menschen beherbergt werden. Hinzu kommen Millionen Menschen, die wegen steigender Meeresspiegel und sich ausbreitender Wüsten (sowie wegen Kriegen und Konflikten) in andere Regionen der Erde migrieren.
2) Sanieren will gelernt sein
Leerstand findet sich meist nicht da, wo neuer umbauter Raum benötigt wird. Ist dies allerdings doch einmal der Fall, dann sollte vor einer Entscheidung für Abriss und Neubau sorgfältig geprüft werden, ob sich nicht auch die alten Gemäuer für die geplante neue Nutzung eignen. Sehr häufig wird dies der Fall sein – und sollte dann auch die bevorzugte Option der Planenden sein. Eine Sanierung kann bis zu 60 % der sog. grauen Emissionen einsparen. Bei Infrastrukturbauten liegt der Prozentsatz sogar noch höher. Dazu werden auch deutlich weniger Primärmaterialien benötigt als für einen Neubau. Doch warum zögern immer noch viele Bauherren vor diesem Schritt, selbst wenn die grundsätzlichen Rahmenbedingungen (wie z. B. der Zustand der Bausubstanz und die Geschosshöhe) dafür sprechen? Die Erfahrung zeigt: Sanierungsprojekte sind ökologisch vorteilhaft, aber oft komplizierter und anspruchsvoller als Abriss und Neubau. Und im Bauwesen bedeutet „kompliziert“ häufig auch, dass etwas wesentlich teurer wird als erwartet. Schubladenlösungen funktionieren hier nicht. Die Kostenfalle kann nur vermeiden, wer mit exzellenten Planerinnen und Planern arbeitet und auf smarte, technologiegestützte Lösungen setzt, die den Bestandserhalt vereinfachen.
3) Normierungen und Vorschriften – der Dschungel muss sich lichten
Es existieren derzeit circa 3.900 baurelevante Normen. Davon beziehen sich zwar „nur“ circa 350 auf den Geschosswohnungsbau, die Menge an zu beachtenden Regelungen und Empfehlungen ist dennoch enorm. Hinzu kommen je nach Zertifizierungssystem oder Förderprogramm noch eine Vielzahl an weiteren Aspekten, die begriffen und eingehalten werden müssen. Natürlich bedarf es allgemeingültiger Regeln, die dafür sorgen, dass kein Risiko für Leib und Leben und für die Natur besteht. Doch die Zahl und Komplexität der Normen steigt immer weiter an. Und mit jedem Anstieg wird das Bauen nicht nur komplexer und komplizierter, sondern auch teurer und meist materialintensiver. Genau dieser zuletzt genannte Aspekt lässt viele Planende, denen an einer Material- und Emissionsreduktion gelegen ist, regelmäßig verzweifeln. Die Architektenkammer Bayern wagte mit ihrer Initiative Gebäudeklasse E einen interessanten Vorstoß. Wir brauchen mehr solcher Initiativen. Wer, wenn nicht die neuen Generationen an Planenden sollten sie anstoßen?
4) Digitalisierung tut Not!
Die Digitalisierung in Deutschland muss sektorübergreifend ausgebaut werden. Das gilt auch und insbesondere für das Bauwesen. Zwar ist mittlerweile BIM Level 1 relativ verbreitet, das volle Potenzial von digitalen Zwillingen nicht nur während der Planung, sondern auch bei der Ausführung, dem Betrieb, der Instandhaltung und beim Rückbau wird allerdings bei Weitem nicht ausgeschöpft. Die Hoffnung besteht, dass mit den neuen Planenden-Generationen auch mehr digitale Affinität in die Planungs- und Baubüros einzieht und dadurch Prozesse vereinfacht, Softwarelösungen programmiert, Bauwerke optimiert und somit Zeit und Ressourcen gespart werden. In interdisziplinären Teams arbeiten wir auch bei Werner Sobek an Softwarelösungen, die uns simultan Lebenszyklusdaten und Optimierungsvorschläge aufzeigen, um so deutlich nachhaltiger bauen zu können.
5) Nachhaltigkeit kommt nicht von ungefähr
Nachhaltigkeit muss zwingend holistisch gedacht werden, und zwar von der ersten Entwurfsidee an. Was ist wirklich notwendig? Wo kann eingespart werden (Stichwort: Tiefgarage!)? Welchen Mehrwert kann das Projekt bieten? Was sind die zentralen Ziele, die erreicht werden sollen? Die Weichen hin zu mehr Nachhaltigkeit werden zu Beginn gestellt – das heißt aber nicht, dass im Lauf des Projekts keine Rückschläge zu befürchten sind, ganz im Gegenteil. Daher heißt es: Dranbleiben, Finger heben, Alternativen aufzeigen, Probleme lösen und Netzwerke aktivieren. Das ist anstrengend, komplex und facettenreich; ein multidisziplinäres Unterfangen, das insbesondere von Berufsanfängerinnen und -anfängern sehr viel abverlangt – das sich aber allemal lohnt.
Es gibt noch sehr viel zu tun, wenn wir die Transformation unserer gebauten Umwelt hin zu mehr Nachhaltigkeit zeitnah bewerkstelligen wollen. Aber was für eine Perspektive: Wir können heute durch unseren Einsatz für ein besseres Bauen nicht nur etwas für unseren beruflichen Erfolg tun, sondern ebenso einen wichtigen Beitrag dazu leisten, unseren Planeten für kommende Generationen zu bewahren. Der Beruf der Planenden hat sich weiterentwickelt, birgt ungeahnte Herausforderungen und fordert neue Kenntnisse, aber er ist und bleibt irrsinnig spannend! Auch wenn die ersten Jahre nach der Hochschule also anstrengend sein sollten – werft auf keinen Fall die Flinte ins Korn, zum Wohle von uns allen!
Zum Unternehmen
Die Werner Sobek AG ist ein weltweit tätiges Fachplanungsbüro für nachhaltiges Engineering und Design im Bauwesen mit Hauptsitz in Stuttgart. Das 1992 gegründete Unternehmen umfasst mehr als 450 Mitarbeitende und hat Büros in Europa, Nordamerika und dem Mittleren Osten. Die Arbeiten des Unternehmens zeichnen sich durch hochwertige Gestaltung und ausgeklügelte Konzepte zur Minimierung von Emissionen sowie von Energie- und Materialverbrauch aus.




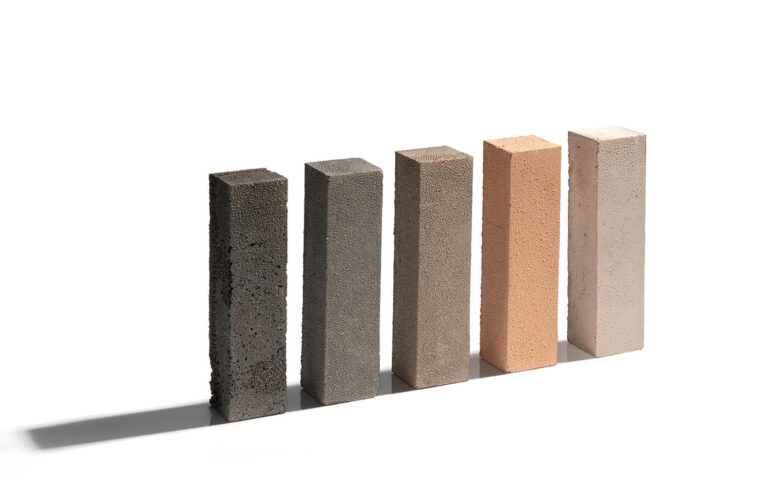









 Vom neuen Wien Museum über die Faserverbundfassade für das Texoversum in Reutlingen bis zum Skywalk Königsstuhl in Sassnitz – das aktuelle Jahrbuch Ingenieurbaukunst 2025 versammelt die Spitzenleistungen des Bauingenieurwesens. In den Beiträgen werden die bautechnischen Herausforderungen sowie die konkreten Lösungen bei Planung und Ausführung beschrieben. Die von einem unabhängigen Beirat ausgewählten Bauwerke und Diskussionsthemen heben die Leistungen des deutschen Bauingenieurwesens hervor. Der Band ist zugleich ein Forum für aktuelle Debatten rund um das Planen und Bauen, diesmal insbesondere zu den Beiträgen des Ingenieurbaus zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Bundesingenieurkammer (Hrsg.). Ingenieurbaukunst 2025: Made in Germany. 208 Seiten. Ernst & Sohn 2024. 49,90 €.
Vom neuen Wien Museum über die Faserverbundfassade für das Texoversum in Reutlingen bis zum Skywalk Königsstuhl in Sassnitz – das aktuelle Jahrbuch Ingenieurbaukunst 2025 versammelt die Spitzenleistungen des Bauingenieurwesens. In den Beiträgen werden die bautechnischen Herausforderungen sowie die konkreten Lösungen bei Planung und Ausführung beschrieben. Die von einem unabhängigen Beirat ausgewählten Bauwerke und Diskussionsthemen heben die Leistungen des deutschen Bauingenieurwesens hervor. Der Band ist zugleich ein Forum für aktuelle Debatten rund um das Planen und Bauen, diesmal insbesondere zu den Beiträgen des Ingenieurbaus zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Bundesingenieurkammer (Hrsg.). Ingenieurbaukunst 2025: Made in Germany. 208 Seiten. Ernst & Sohn 2024. 49,90 €.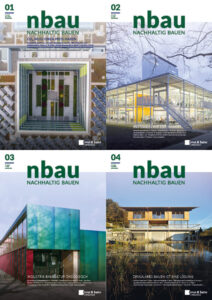 Die Zeitschrift „
Die Zeitschrift „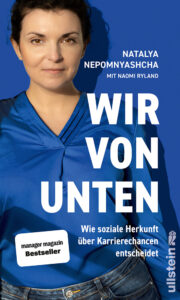 Vom Hartz-IV-Kind zum Dax-CEO? Natalya Nepomnyashcha fordert, dass dies möglich sein muss. Sie selbst hat sich hochgekämpft. In ihrem Buch erzählt sie offen von ihrem zähen Weg nach oben Sie berichtet, wie sie aufgrund ihrer Hartz-IV-Herkunft immer wieder diskriminiert wurde – bis ihr nach vielen Jahren der Karrieredurchbruch gelang. Sie macht jungen Menschen Mut. Zugleich zeigt Nepomnyashcha, wie stark unsere Gesellschaft davon profitiert, wenn Menschen unterschiedlicher sozialer Herkünfte auf allen Ebenen zusammenarbeiten. Anhand ihrer eigenen Geschichte, mithilfe von Fallbeispielen und der Lage in Unternehmen zeigt sie, wie Aufsteigerinnen und Aufsteiger in Unternehmen, Politik und Gesellschaft wirken können – und warum das gut für alle ist. Im Oktober 2024 wurde sie für ihren Einsatz für mehr Chancengerechtigkeit mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Natalya Nepomnyashcha. Wir von unten. Wie soziale Herkunft über Karrierechancen entscheidet. 272 Seiten. Ullstein 2024. 19,99 €.
Vom Hartz-IV-Kind zum Dax-CEO? Natalya Nepomnyashcha fordert, dass dies möglich sein muss. Sie selbst hat sich hochgekämpft. In ihrem Buch erzählt sie offen von ihrem zähen Weg nach oben Sie berichtet, wie sie aufgrund ihrer Hartz-IV-Herkunft immer wieder diskriminiert wurde – bis ihr nach vielen Jahren der Karrieredurchbruch gelang. Sie macht jungen Menschen Mut. Zugleich zeigt Nepomnyashcha, wie stark unsere Gesellschaft davon profitiert, wenn Menschen unterschiedlicher sozialer Herkünfte auf allen Ebenen zusammenarbeiten. Anhand ihrer eigenen Geschichte, mithilfe von Fallbeispielen und der Lage in Unternehmen zeigt sie, wie Aufsteigerinnen und Aufsteiger in Unternehmen, Politik und Gesellschaft wirken können – und warum das gut für alle ist. Im Oktober 2024 wurde sie für ihren Einsatz für mehr Chancengerechtigkeit mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Natalya Nepomnyashcha. Wir von unten. Wie soziale Herkunft über Karrierechancen entscheidet. 272 Seiten. Ullstein 2024. 19,99 €.