Forschende gehen davon aus, dass der Kampf gegen die Klimakrise ein neues Level erreicht. Es geht nun um sofort wirkende Maßnahmen – und ergänzend um Wege, CO₂ aus der Luft zu holen und zu speichern. Trendforscher sprechen von einer Blauen Ökologie, die technologisch getrieben sein wird. Gefragt ist dabei die Innovationskraft der Ingenieur*innen: Sie sind die Möglichmacher, die in den Unternehmen die dafür notwendigen Techniken entwickeln und umsetzen. Ein Essay von André Boße
„Die Zukunft beginnt, wenn die Möglichkeiten des Wandels in uns aufscheinen.“ Mit diesem beinahe poetischen Satz beschreibt Matthias Horx, Chef des Zukunftsinstituts, den Leitbegriff des „Zukunftsreports 2023“ – die „Zukunftswende“.
Angelehnt ist dieses Wort an die von Bundeskanzler Olaf Scholz ausgerufene Zeitenwende. Inhaltlich stehe die Zukunftswende, so Horx, für ein „possibilistisches Denken“, oder auch: „das Denken in Möglichkeiten“, um den vielen Krisen zu begegnen, allen voran der drohenden Klimakatastrophe.
Blaue Ökologie kombiniert Technologie, intelligente Systeme und Bewusstseinswandel zu einer neuen Veränderungslogik.
Eine dieser Möglichkeiten lautet: Neue Technologien sind in der Lage mitzuhelfen, die Klimakrise zu lösen. Nötig dafür ist, so heißt es im „Zukunftsreport 2023“, eine Blaue Ökologie, und diese sei mehr noch als die Grüne Ökologie ein Technikthema, wie es im Zukunftsreport heißt: „Transformationstechnologien, die sich heute schnell entwickeln, machen es möglich, eine ökologische, postfossile Lebensweise als sinn- vollen Gewinn zu definieren – einen Gewinn an Lebensqualität und Zukunftssicherheit.“ Dabei sei die Blaue Ökologie eine „konstruktive Ökologie“: „Sie kombiniert Technologie, intelligente Systeme und Bewusstseinswandel zu einer neuen Veränderungslogik.“
Unternehmen sitzen an zwei Hebeln
Treiber dieser Veränderungslogik sind die Politik und die Gesellschaft – sowie verstärkt die Unternehmen. Diese sitzen an gleich zwei Hebeln: Erstens stehen sie vor der Aufgabe, ihre eigene Klimabilanz immer weiter zu verbessern, bis hin zum Nahziel eines wirklich klimaneutralen Wirtschaftens.
Zutrauen in Technik steigt
Der TechCompass 2023, eine von Bosch in Auftrag gegebene repräsentative weltweite Umfrage, kommt zu dem Ergebnis, dass 75 Prozent der Befragten glauben, der technologische Fortschritt mache die Welt besser. 83 Prozent sind der Ansicht, die Technologie spiele eine Schlüsselrolle bei der Bekämpfung der Erderwärmung. „Die Menschen erwarten von Unternehmen Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels“, wird Dr. Stefan Hartung, Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH, in der Pressemeldung zur Vorstellung des TechCompass 2023 zitiert.
Zweitens besitzen insbesondere die technischen Unternehmen die Mitverantwortung, Methoden und Wege zu entwickeln, um die Klimakrise mit Hilfe neuer Technologien zu bekämpfen. Um diese beiden Hebel zu bedienen, ist das Wissen von Ingenieur*innen gefragt. Sie sind es, die mit ihrem Denken und ihrem Know-how das vom Zukunftsinstitut geforderte „Denken in Möglichkeiten“ so umzusetzen, dass Innovationen im Sinne des Klimaschutzes entstehen.
Beginnen wir mit den Maßnahmen innerhalb von Unternehmen, um die selbst gesteckten Klimaziele zu erreichen. Das NewClimate Institute, ein Kölner Thinktank für Ideen im Kampf gegen die Klimakrise, und die Initiative Carbon Market Watch, die sich in Brüssel mit Modellen zur Bepreisung von CO₂ -Emissionen beschäftigt, haben für ihren „Corporate Climate Responsibility Monitor 2023“ 24 große, international tätige Unternehmen, die sich selbst als führend im Bereich des Klimaschutzes bezeichnen, daraufhin untersucht, ob sie ihre Klimaschutzversprechen auch einhalten.
Das Ergebnis ist ernüchternd: Um in Linie mit dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens zu stehen, müssten diese Unternehmen ihre Treibhausgas-Emissionen bis 2030 um mindestens 43 Prozent verringern. Tatsächlich betrage, so die Studie, die Reduzierung mutmaßlich jedoch nur 15 Prozent – und selbst bei dem optimistischsten Szenario bis 2030 nur 21 Prozent.
Die Unternehmen müssen dringend sinnvolle und wirklich wirksame Maßnahmen entwickeln, um die Emissionen nach unten zu bringen.
Als problematisch bewerten die Studienautor*innen die Tatsache, dass nur die wenigsten der untersuchten Unternehmen ihrer selbsternannten Führungsrolle im Kampf gegen die Klimakrise gerecht werden. So fehle es in vielen Fällen an Transparenz sowie an Best-Practice-Beispielen. Stattdessen setzen drei Viertel der untersuchten Unternehmen auf den Weg der Emissionskompensation durch das Anpflanzen von Bäumen. Klar, das hilft. Doch für die Durchführung fehlt auf diesem Planeten der Platz: Würden auch andere Unternehmen diesen Ansatz der selbst ernannten Vorreiter nachahmen, bräuchte man für die Realisierung die natürlichen Ressourcen von zwei bis vier Erden.
Was der „Corporate Climate Responsibility Monitor 2023“ zeigt: Die Unternehmen müssen dringend sinnvolle und wirklich wirksame Maßnahmen entwickeln, um die Emissionen nach unten zu bringen. Auf dem Papier stimmen die Ziele. Jetzt sind die Unternehmen gefragt, zusammen mit Ingenieur*innen dafür zu sorgen, dass diese auch umgesetzt werden.
Fleisch aus dem Labor
Nun könnte man fragen, ob es sinnvoll ist, von den Unternehmen zu erwarten, Techniken für den Kampf gegen den Klimawandel zu entwickeln, wenn viele von ihnen nicht einmal in der Lage sind, die internen Klimaziele zu erreichen. Aber wie heißt es im Zukunftsreport: Es gehe um das „Denken in Möglichkeiten“. Also packen wir diese beim Schopfe. Was also gibt es zu tun?
Beginnen wir bei der Massentierhaltung. Vor wenigen Jahren ging eine Untersuchung des in Amerika ansässigen Institute for Agriculture & Trade Policy, das nachhaltige Tierzucht- und Farming-Modelle entwickelt, durch die Nachrichten. Dem-nach seien die fünf weltgrößten Fleisch- und Molkereikonzerne zusammen für mehr Treibhausgas-Emissionen verantwortlich als jeweils die drei größten Ölkonzerne.
Mondstaub gegen die Klimakrise
Rettet uns der Mond? Anfang Februar dieses Jahres machte eine Meldung die Runde, nach der US-Wissenschaftler untersucht haben, ob aufgewirbelter Mondstaub helfen kann, die Kraft der Sonne zu reduzieren und damit die Erderwärmung einzudämmen. Das Resultat der im Magazin PLOS Climate veröffentlichten Studie: Er könnte, rein theoretisch. Jedoch sei es kaum möglich, den Staub lange in der Umlaufbahn zu halten. Sowieso sei es den beiden Forschern nicht um die logistische Machbarkeit gegangen, sondern um die Berechnung potenzieller Auswirkungen.
In den Fokus rückt daher seit einiger Zeit die Fleischproduktion, bei der aus Stammzellen von Nutztieren In-Vitro-Fleisch gezüchtet wird. Noch ist diese Fleisch-Variante in Europa nicht zugelassen, in Ländern wie Singapur jedoch schon. Eine Studie der Universität Osnabrück zeigte Mitte vergangenen Jahres, dass 65 Prozent der Befragten nach einer Beschreibung eines In-Vitro-Burgers angaben, diesen zu probieren, 50 Prozent könnten sich vorstellen, ihn zu kaufen, „47 Prozent stimmten sogar zu, dass sie einen solchen Burger öfter anstelle herkömmlichen Fleischs nutzen wollen würden“, heißt es in der Pressemitteilung zur Studie.
Ob und inwieweit sich In-Vitro-Fleisch in Deutschland durchsetzen werde, hänge neben rechtlichen und technischen Herausforderungen stark von der Akzeptanz der Konsumentinnen und Konsumenten ab, erklärt der Biologiedidaktiker Dr. Florian Fiebelkorn, einer der Studienautor*innen. „Im Vergleich zu konventionellem Fleisch ist die Produktion wesentlich nachhaltiger, denn man benötigt beispielsweise weniger Fläche und Wasser“, wird er zitiert. Auch der Aspekt des Tierwohls spricht für das Fleisch aus dem Labor.
Schwieriger dagegen ist die Energiebilanz: Zur Herstellung wird viel Strom benötigt. Und sollte In-Vitro-Fleisch eines Tages tatsächlich ein ernsthafter Konkurrent von Fleisch aus Massentierhaltung werden oder dieses auf lange Sicht sogar ersetzen, muss sich zeigen, wie sich diese potenzielle Massenproduktion auf den Strombedarf auswirkt. Dennoch zeigt die Entwicklung von In-Vitro-Fleisch: Es gibt technische Alternativen zu den größten Klimasündern. Investoren und Konzerne, Politik und Gesellschaft – alle tun gut daran, diesen Optionen eine Chance zu geben.
Deutsche Gründer filtern CO₂ aus der Luft
Weniger CO₂ freizusetzen, ist für den Klimaschutz der Königsweg. Je länger es jedoch dauert, bis die Einsparungen wirklich wirksam werden, desto größer wird der Bedarf nach Techniken, die in der Lage sind, Treibhausgase aus der Atmosphäre zu filtern – um sie dann auf der Erde zu speichern: auf dem Land, im Wasser, in geologischen Formationen oder in Produkten. Der Report „The State of Carbon Dioxide Removal“, den ein internationaler Zusammenschluss von Forschenden Anfang 2023 veröffentlicht hat, bewertet Lösungen so genannter Negativer Emissionstechnologien (englisch: Carbon Dioxide Removal, kurz: CDR). Bereits im ersten Satz der Studienzusammenfassung legen sich die Expert*innen fest: CDR-Techniken zu skalieren, sei – zusammen mit der Reduzierung der Emissionen – eine dringliche Priorität, um das 1,5-Grad-Ziel des Paris-Abkommens zu erreichen.
Die Zukunft beginnt, wenn die Möglichkeiten des Wandels in uns aufscheinen.
Zwei Techniken spielen im Report eine gewichtige Rolle. Einmal Bioenergy with Carbon Capture and Storage, kurz BECCS: Biomasse, die CO₂ aus der Luft zieht, wird in Biogasanlagen genutzt, um Strom oder Wärme zu erzeugen. Das bei der Verbrennung freigesetzte CO₂ wird eingefangen und in Lagerstätten unter der Erde oder im Meer gespeichert. Technisch anspruchsvoller ist die Methode Direct Air Carbon Capture and Storage, kurz DACCS: Hier wird das CO₂ mit Hilfe großer Sauganlagen gezielt aus der Luft gefiltert und dann gespeichert.
In Island hat das schweizerische Unternehmen Climeworks erste Erfolge mit dieser technischen Innovation erlangt: Ein Filtersystem schneidet das CO₂ aus der Luft ab, ein Partnerunternehmen aus Island übernimmt die Aufgabe, das Treibhausgas danach in tiefe Gesteinsschichten der vulkanischen Insel zu bringen, wo es gespeichert wird. Auf der Unternehmenshomepage betonen die beiden deutschen Gründer von Climeworks, Christoph Gebald und Jan Wurzbacher, die Technik sei kein Freibrief für weitere CO₂-Ausstöße, sondern eine Methode, um in Zukunft notwendige und unvermeidbare Emissionen zu neutralisieren – und zudem ein „Safeguard“, der dabei hilft, die Erderwärmung auf 1,5- Grad zu drücken, wenn die Welt ihr Klimaziel zunächst nicht erreicht.
Regierungen sind gefragt
Auch im Report „The State of Carbon Dioxide Removal“ heißt es, die CDR-Techniken seien keine „Wunderwaffen“, um den Klimawandel zu bekämpfen. Aber: „CO₂-Entnahmen sind eine Notwendigkeit“, formuliert es Prof. Dr. Jan Christoph Minx, Leiter der Forschungsgruppe Angewandte Nachhaltigkeitsforschung beim Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change und einer der Autoren des Berichts, in der Pressemitteilung zur Vorstellung der Studie.
Lösungen des Klimaproblems einfach erklärt
In der öffentlichen Debatte über den Klimawandel geht es viel zu oft drunter und drüber, meinen David Nelles und Christian Serrer. Deshalb wollten die beiden Studenten wissen: Wie groß ist der Beitrag des Menschen tatsächlich? Müssen wir jedes Jahr Ernteausfälle befürchten? Was bedeutet der Klimawandel für unsere Gesundheit? Was kostet uns der Klimawandel? Mit kurzen Texten, anschaulichen Grafiken und der Unterstützung von über 250 Wissenschaftler*innen erklären die beiden die Maßnahmen zur Lösung des Klimaproblems. Ihr Ziel: so viele Menschen wie möglich zu erreichen, „denn den Klimawandel können wir nur aufhalten, wenn jeder von uns mit anpackt“, so die Autoren. David Nelles, Christian Serrer: Machste dreckig – Machste sauber: Die Klimalösung. KlimaWandel 2021. 10 Euro
„Die CO₂-Entnahmen werden nicht vom Himmel fallen. Wir müssen uns darum kümmern. Nur so können wir eben zu einer zirkulären Kreislaufwirtschaft für CO₂ kommen. Und dahin müssen wir.“ Entscheidend seien die nächsten zehn Jahre: „Was wir bis dahin umsetzen können, entscheidet darüber, in welchem Umfang die Entnahmemethoden bis Mitte des Jahrhunderts skaliert werden können.“ Sein Studien-Autorenkollege Dr. Oliver Gerden nimmt die Politik in die Pflicht, schließlich sei die Technik vorhanden.
Daher müssten Regierungen, insbesondere diejenigen, die Netto-Null-Ziele beschlossen haben, öffentlich sagen: Wie viel CO₂-Entnahme wollen sie durchsetzen? Mit welchen Methoden? Wer wäre dafür verantwortlich? Und wer zahlt das? Wer darauf keine Antwort habe, „dessen Netto-Null-Ziel kann man eigentlich nicht wirklich ernst nehmen“, so der Forscher.
Wie heißt es so schön im „Zukunftsreport 2023“ der Trendforscher des Zukunftsinstituts? „Die Zukunft beginnt, wenn die Möglichkeiten des Wandels in uns aufscheinen.“ Bedeutet beim Thema Erderwärmung konkret: Die Zukunft des Kampfes gegen die Klimakrise beginnt, wenn Ingenieur*innen neue Techniken entwickeln und umsetzen, um Emissionen wirksam zu vermeiden oder Treibhausgase aus der Luft zu filtern.





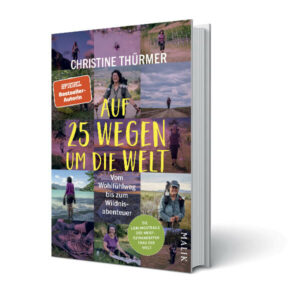 Christine Thürmer: Auf 25 Wegen um die Welt. Malik 2023. 18,00 Euro
Christine Thürmer: Auf 25 Wegen um die Welt. Malik 2023. 18,00 Euro





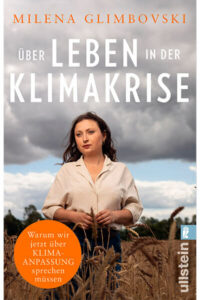 Ansteigende Temperaturen, massive Dürre, extreme Wetterphänomene – die Klimakrise ist längst auch in Deutschland angekommen. Die Trinkwasserversorgung ist nicht mehr sicher, die Landwirtschaft hat es so schwer wie nie zuvor, der Meeresspiegel steigt. Doch selbst wenn die politisch Verantwortlichen die große Katastrophe noch abwenden können: Viele klimatische Veränderungen sind nicht mehr rückgängig zu machen. Milena Glimbovski, Aktivistin und Gründerin des ersten Unverpackt-Ladens in Berlin, stellt in ihrem Buch konkrete Maßnahmen vor, die wir politisch, aber auch privat umsetzen müssen, um eine klimaresiliente
Ansteigende Temperaturen, massive Dürre, extreme Wetterphänomene – die Klimakrise ist längst auch in Deutschland angekommen. Die Trinkwasserversorgung ist nicht mehr sicher, die Landwirtschaft hat es so schwer wie nie zuvor, der Meeresspiegel steigt. Doch selbst wenn die politisch Verantwortlichen die große Katastrophe noch abwenden können: Viele klimatische Veränderungen sind nicht mehr rückgängig zu machen. Milena Glimbovski, Aktivistin und Gründerin des ersten Unverpackt-Ladens in Berlin, stellt in ihrem Buch konkrete Maßnahmen vor, die wir politisch, aber auch privat umsetzen müssen, um eine klimaresiliente
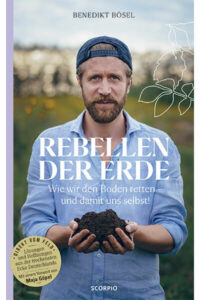 Nachdem Benedikt Bösel vor sechs Jahren den elterlichen Bauernhof in Brandenburg mit 3.000 Hektar Land und Forst übernommen hatte, wollte er den Beweis antreten, dass es möglich ist, zerstörte Nährstoffkreisläufe wieder zu schließen und damit nicht nur Extremwetterereignissen und Ernteausfällen zu trotzen, sondern auch das Mikroklima günstig zu beeinflussen. In seinem Buch berichtet der Landwirt des Jahres 2022 über seine weltweite Suche nach alternativen Landnutzungsmodellen und von seinen Erfolgen. Benedikt Bösel: Rebellen der Erde. Wie wir den Boden retten – und damit uns selbst! Scorpio Verlag 2023. 26 Euro
Nachdem Benedikt Bösel vor sechs Jahren den elterlichen Bauernhof in Brandenburg mit 3.000 Hektar Land und Forst übernommen hatte, wollte er den Beweis antreten, dass es möglich ist, zerstörte Nährstoffkreisläufe wieder zu schließen und damit nicht nur Extremwetterereignissen und Ernteausfällen zu trotzen, sondern auch das Mikroklima günstig zu beeinflussen. In seinem Buch berichtet der Landwirt des Jahres 2022 über seine weltweite Suche nach alternativen Landnutzungsmodellen und von seinen Erfolgen. Benedikt Bösel: Rebellen der Erde. Wie wir den Boden retten – und damit uns selbst! Scorpio Verlag 2023. 26 Euro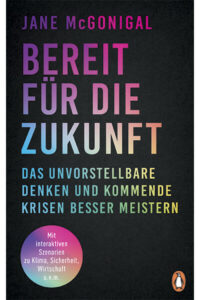 Die Zukunft ist unberechenbar, doch wir können uns auf sie vorbereiten, ganz gleich, welche Herausforderungen sie für uns bereithält. Das ist die These von Jane McGonigal, Spieleentwicklerin und zugleich eine der einflussreichsten Zukunftsforscherinnen. Die Forschungsleiterin am Institute for the Future in Palo Alto/Kalifornien zeigt in ihrem Buch „Bereit für die Zukunft. Das Unvorstellbare denken und kommende Krisen besser meistern“, wie wir die richtigen Fähigkeiten entwickeln können: ein Denken, das auf unvorhergesehene Herausforderungen schneller reagiert; die Inspiration, heute die richtigen Weichen für unser Leben in der Zukunft zu stellen; die Kreativität, Probleme auf nie dagewesene Weise zu lösen. Die Zukunft lässt sich nicht vorhersagen. Wir aber können uns auf das vorbereiten, was heute noch niemand kommen sieht. Jane McGonigal Bereit für die Zukunft. Das Unvorstellbare denken und kommende Krisen besser meistern. Penguin Verlag. 24 Euro
Die Zukunft ist unberechenbar, doch wir können uns auf sie vorbereiten, ganz gleich, welche Herausforderungen sie für uns bereithält. Das ist die These von Jane McGonigal, Spieleentwicklerin und zugleich eine der einflussreichsten Zukunftsforscherinnen. Die Forschungsleiterin am Institute for the Future in Palo Alto/Kalifornien zeigt in ihrem Buch „Bereit für die Zukunft. Das Unvorstellbare denken und kommende Krisen besser meistern“, wie wir die richtigen Fähigkeiten entwickeln können: ein Denken, das auf unvorhergesehene Herausforderungen schneller reagiert; die Inspiration, heute die richtigen Weichen für unser Leben in der Zukunft zu stellen; die Kreativität, Probleme auf nie dagewesene Weise zu lösen. Die Zukunft lässt sich nicht vorhersagen. Wir aber können uns auf das vorbereiten, was heute noch niemand kommen sieht. Jane McGonigal Bereit für die Zukunft. Das Unvorstellbare denken und kommende Krisen besser meistern. Penguin Verlag. 24 Euro


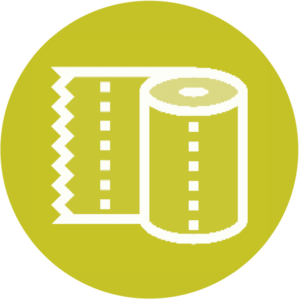


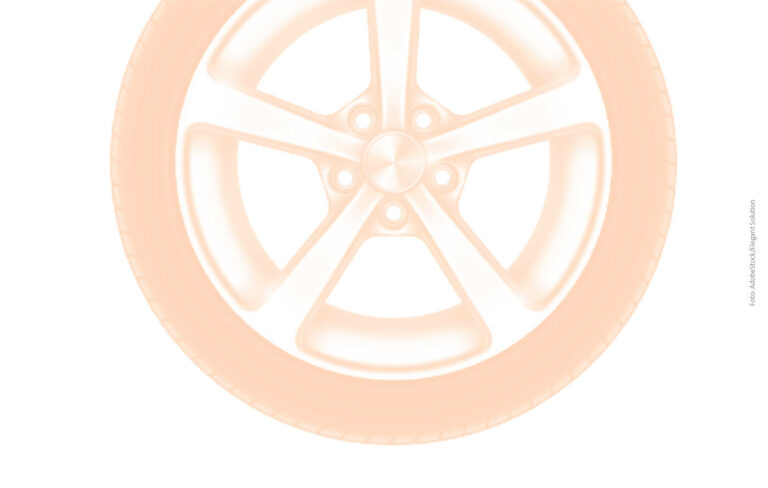


 Als Teil der Bau-Familie übernimmst Du Verantwortung für die Verwirklichung einer resilienten, nachhaltigen und innovativen Lebenswelt. Gemeinsam schaffen wir neue Räume für unsere Gesellschaft, verpassen unserer Infrastruktur ein zukunftsfestes Update, erschließen neue Möglichkeiten der Energiegewinnung und sorgen im öffentlichen wie privaten Sektor dafür, dass das Herz unserer Wirtschaft im Takt bleibt. Wir schaffen Werte, die bleiben und versetzen – wenn es sein muss – auch Berge. Dabei bist Du als Bauingenieur:in Kopf und Herz des Aufbruchs in eine neue Zukunft des Bauens. Denn der Strukturwandel im Bauwesen beginnt mit Dir.
Als Teil der Bau-Familie übernimmst Du Verantwortung für die Verwirklichung einer resilienten, nachhaltigen und innovativen Lebenswelt. Gemeinsam schaffen wir neue Räume für unsere Gesellschaft, verpassen unserer Infrastruktur ein zukunftsfestes Update, erschließen neue Möglichkeiten der Energiegewinnung und sorgen im öffentlichen wie privaten Sektor dafür, dass das Herz unserer Wirtschaft im Takt bleibt. Wir schaffen Werte, die bleiben und versetzen – wenn es sein muss – auch Berge. Dabei bist Du als Bauingenieur:in Kopf und Herz des Aufbruchs in eine neue Zukunft des Bauens. Denn der Strukturwandel im Bauwesen beginnt mit Dir.