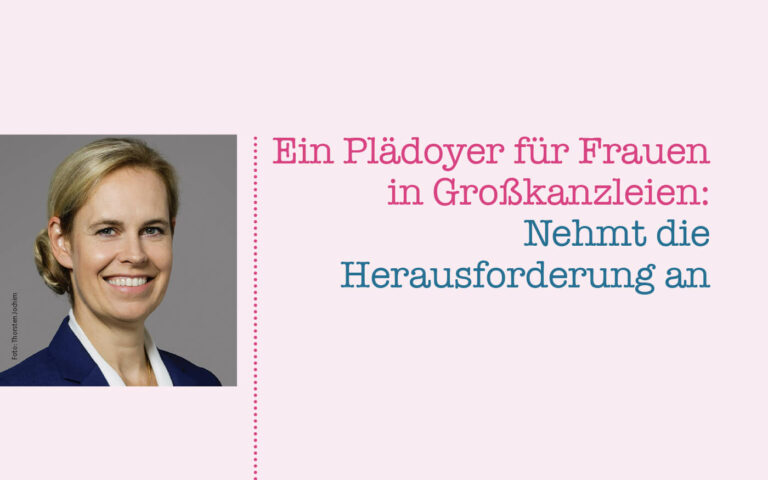Verglichen mit anderen Branchen ist der Rechtsmarkt starr und wird von Konventionen geprägt. Jedoch verlangen digitale Techniken und der Anspruch der jungen Generation auch in den Kanzleien nach Innovationen. Entwickelt werden können diese von innen heraus – mit Hilfe von Intrapreneuren, die in der Organisation so arbeiten, als führten sie ein eigenes Unternehmen. Kanzleien sollten internen Unternehmergeist fördern – und seine ungewöhnlichen Wege aushalten. Ein Essay von André Boße
Man tut dem Rechtsmarkt nicht unrecht, wenn man ihn im Vergleich zu anderen Branchen als verhältnismäßig konservativ charakterisiert. Das liegt einerseits an der Arbeit selbst: Juristische Exzellenz ist ein Attribut, bei dem es auch darum geht, das Vertrauen der Mandant*innen zu gewinnen. Wer hier zu progressiv unterwegs ist, könnte für Verwirrung sorgen. Zu tun hat das auch mit der Struktur vieler Kanzleien. Sie beruhen auf dem Modell der Partnerschaften, müssen ohne Risikokapital oder Investoren auskommen – eine Tatsache, die mutiges Denken zumindest nicht fördert (siehe dazu auch das Top-Interview in dieser Ausgabe).
Digitalisierung verlangt nach Innovationen
Also, alles beim Alten belassen? Auch das ist nicht mehr möglich. Die Digitalisierung verändert die Arbeit in den Sozietäten. „Kanzleien und Rechtsabteilungen müssen sich digital transformieren und ihre Geschäftsmodelle überdenken“, schreibt Clara Raschewski, Head of Innovation and Legal Tech in der Wirtschaftskanzlei SKW Schwarz, in einem Meinungsbeitrag auf dem Portal legal-tech.de. Ihre These: Durch die Entstehung neuer Technologien verändern sich Arbeitsweisen und die Art und Weise der Kommunikation: „Damit die digitale Transformation in der Rechtswelt gelingt und die Wettbewerbsfähigkeit bestehen bleibt, braucht es Innovation.“
Wer sich nicht mit disruptiven Technologien auseinandersetzt und sich nicht den Ansprüchen der Mandant*innen stellt, befindet sich früher oder später auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit. — Clara Raschewski, SKW Schwarz
Wo aber sollen diese Innovationen entwickelt werden, in einem Markt, der anders funktioniert als andere Branchen? Clara Raschewski bringt in ihrem Beitrag das Problem auf den Punkt, wenn sie schreibt, dass es für Innovation in Kanzleien ein Mindset geben müsse, das „Offenheit, Zusammenarbeit und Experimentierfreude fördert und Mitarbeitende ermutigt, neue Ideen einzubringen und umzusetzen“. Genau hier erkenne sie aber das Problem: „Die Veränderung der Gesellschaft und explizit der Tech-Welt vollzieht sich sehr schnell, und somit prallt Technologie auf eine konventionelle, starre juristische Welt.“ Wobei die Autorin auch klarstellt, dass ein Festhalten an den Konventionen keine Option darstelle: „Wer sich nicht mit disruptiven Technologien auseinandersetzt und sich nicht den Ansprüchen der Mandant*innen stellt, befindet sich früher oder später auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit.“
Nachwuchs will sich früh einbringen
Ein neues Mindset muss also her. Gemeint ist eine Kanzleikultur, die die Eigeninitiative der Mitarbeitenden fördert – und zwar explizit mit Blick auf die junge Generation. Diese bringt nicht nur den Vorteil mit, die digitale Technik schon von Kindesbeinen an zu kennen, sie stellt auch den Anspruch, sich in den Kanzleien von Beginn an einbringen zu wollen, von Beginn an nach dem Motto: mittendrin statt nur dabei. Ein Blick nach Düsseldorf, wo die international tätige Wirtschaftskanzlei Herbert Smith Freehills neben Frankfurt einen Standort hat.
 Intrapreneurship in der juristischen Ausbildung
Intrapreneurship in der juristischen Ausbildung
Die befragten Kanzleien stellen klar, dass sich die Ausbildung an den Universitäten überwiegend an juristischen Inhalten orientiert. „Aus unserer Sicht könnte der Unternehmergeist im Rahmen der akademischen Ausbildung durch einen stärkeren Praxisbezug im Studium gefördert werden“, sagt Dr. Christoph Nawroth, Partner bei Herbert Smith Freehills am Standort Düsseldorf. Bis dato bleibe leider „kaum Raum für die frühzeitige Entwicklung unterstützender sozialer und/oder unternehmerischer Kompetenzen“, sagt Dr. Jörg Schneider-Brodtmann, Partner bei Menold Bezler in Stuttgart. Für ihn kommen die „Soft Skills“ – „etwa Gesprächs- und Verhandlungstechniken, aber auch Grundlagen der Unternehmensführung“ – deutlich zu kurz: „Wünschenswert wäre, dass in Zukunft ein Paradigmenwechsel erfolgt und solche Inhalte bereits in die universitäre Ausbildung integriert werden, etwa durch die gezielte Einbindung erfahrener Praktiker in die Curricula.“
Dr. Christoph Nawroth ist dort Corporate Partner, spezialisiert auf alle Aspekte des M&A- und Gesellschaftsrechts. Auf die Frage, wie hoch er bei den Nachwuchskräften den Stellenwert einschätzt, sich von Beginn an einbringen zu können, sagt er: „Wir stellen sehr häufig fest, dass sich junge Anwältinnen und Anwälte aktiv nach diesen Einbringungsmöglichkeiten erkundigen, weil sie eben mehr als nur ‚juristische Sachbearbeiter‘ sein wollen.“ Die Innovationskraft der jungen Generation kann die Kanzlei mit ihrem Fokus auf Wachstum und Innovation gut gebrauchen. Nawroth sagt: „Es ist wesentlicher Teil unserer Unternehmenskultur, dass jeder Partner – einzeln oder gemeinsam mit anderen Partnern – Geschäft generiert und hierbei die Entwicklungen des Marktes im Auge behält. Dabei sind wir ständig darauf bedacht, innovative Lösungen für die Anliegen unserer Mandanten zu finden.“
Auch mal ins Risiko gehen
Um diese Lösungen zu entwickeln und umzusetzen, benötigen die Kanzleien Mitarbeitende, die den Mut und die Offenheit mitbringen, gedanklich auch mal ins Risiko zu gehen. Mitarbeitende also, die so denken, wie es Gründer von Startups tun, die Chancen sehen und Märkte erobern. „Unternehmerisches Denken ist für Anwälte wichtig, weil sich unser Beruf eben nicht in der Rechtsberatung erschöpft, sondern zunehmend auch eine unternehmerische Dimension gewinnt“, bekräftigt Dr. Jörg Schneider-Brodtmann, Partner bei Menold Bezler in Stuttgart mit über 120 Berufsträgern. Neue Mandate am Markt zu gewinnen, erfordere unternehmerisches Denken und Handeln. Ergänzend müsse das eigene, interne „Anwaltsunternehmen“ weiterentwickelt werden.
Das wiederum funktioniert nur, wenn für dieses „Anwaltsunternehmen“ Menschen tätig sind, die innerhalb der Kanzlei unternehmerisch denken und handeln. Die Rede ist hier von Intrapreneuren – von Akteur*innen, die intern so handeln, als würden sie extern ihr eigenes Unternehmen weiterentwickeln.
Apple machte es vor: Intrapreneurship führt zu Erfolg
Das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen Deloitte hat in seinem White-Paper „Fünf Erkenntnisse zu Intrapreneurship“ eine „Anleitung zur Innovationsbeschleunigung“ veröffentlicht. Dafür haben die Verantwortlichen Innovationsprozesse in Organisationen analysiert und bewertet.
Die Schlussfolgerungen der Studie bieten Kanzleien wertvolle Erkenntnisse darüber, worauf es ankommt, um das Intrapreneurship zu stärken. So habe sich laut White-Paper gezeigt, dass erfolgreiches Intrapreneurship einen Bottom-up-Ansatz beschreibe, mit dem Ziel, „radikale Innovationen intern zu entwickeln“.
 Fünf Erkenntnisse zu Intrapreneurship
Fünf Erkenntnisse zu Intrapreneurship
Das White-Paper von Deloitte Digital enthält eine Reihe von Experteninterviews mit erfolgreichen Intrapreneuren und Innovations-Managern unterschiedlicher Konzerne, anhand derer Potenziale und Herausforderungen von Intrapreneurship analysiert wurden. Hieraus resultieren fünf Erkenntnisse, die verdeutlichen, wie der Intrapreneurship- Gedanke in der Organisation verankert werden kann. Das White-Paper steht zum Download auf der Website von Deloitte.
Das Konzept beschreibt dabei keinen Prozess, für dessen Ablauf es ein Handbuch gibt oder der in einer bestimmten Abteilung stattfindet. Worauf es laut Deloitte- Studie stattdessen ankomme, seien „kreative Individuen, die neue Ideen entwickeln“ und die Organisation als „Ganzes vorwärts bringen wollen“. Damit dies gelingt, gehen Intrapreneure unter Umständen bewusst „an den Rand einer Organisation“, schreiben die Autor*innen – mit dem Ziel, dort „bestehende Produkte, Services und Technologien zu erweitern und so die Diversifikation zu erhöhen, neue Firmenpotenziale [zu] entwickeln und Disruption [zu] fördern.“
Die Autor*innen des Deloitte-Reports erinnern an ein Zitat von Apple-Co-Gründer Steve Jobs, der sich Anfang der 80er-Jahre mit einer Gruppe von 20 Mitarbeitern des Unternehmens Apple von der Organisation abspaltete, um autark vom Unternehmen den Macintosh Computer zu entwickeln – die entscheidende Innovation, die Apple später zum großen Player machte. Diese Jobs-Group handelte damals frei und abgekoppelt; Jobs sagte 1985 in einem Interview mit dem US-Magazin Newsweek: „Das Macintosh-Team war das, was man gemeinhin als Intrapreneurship bezeichnet (…) eine Gruppe von Leuten, die mehr oder weniger zurück in eine Garage gingen, allerdings innerhalb eines großen Unternehmens.“
„Garage“ in Kanzleien: Fachteams mit Mandantenkontakt
Nun gibt es in einer Kanzlei keinen Raum mit der Anmutung einer „Garage“. Einen Platz für unternehmerisches Denken existiere aber auch dort, sagt Dr. Jörg Schneider-Brodtmann von Menold Bezler: „Unternehmergeist fördert man am besten dezentral in den Fachteams, unmittelbar in der Mandatsarbeit.“ Ansatz der Kanzlei sei es deshalb, dem Nachwuchs möglichst frühzeitig spannende Aufgaben zur selbstständigen Erledigung im direkten Austausch mit dem Mandanten zu überlassen. „Die Chance, dass sie für sich Unternehmergeist entwickeln, ist dann deutlich größer, als wenn sie nur im Backoffice an Gutachten oder Schriftsätzen mitwirken.“
Was Intrapreneure auszeichne, sei laut Deloitte-White- Paper eine Kombination aus starker Business-Fokussierung und der Fähigkeit, Netzwerke aufzubauen – „was sie dazu befähigt, ihre Idee aktiv im Unternehmen zu festigen“. Wollen also große Kanzleien das Intrapreneurship innerhalb der Organisation fördern, kommt es darauf an, diese Vernetzung zu unterstützen. Die Wirtschaftskanzlei Herbert Smith Freehills versteht sich als „global vernetzte und international agierende Kanzlei“, sagt Partner Dr. Christoph Nawroth. Diese Tatsache erfordere ein „International Mindset“, das von der Kanzlei gefördert werde durch die Möglichkeit für den Nachwuchs, „sich ein internationales Netzwerk aufzubauen und es ständig zu erweitern“. Damit sich dieses Netzwerk fest in der Kanzleikultur verankern kann, bindet auch diese Kanzlei ihren Nachwuchs „eng in die typischerweise internationale Mandatsarbeit mit ein“. Früh Verantwortung zu tragen, damit aber „nicht auf sich allein gestellt“ zu sein, „sondern von einem Mentor begleitet“ zu werden – das ist für Dr. Christoph Nawroth der Weg, Eigeninitiative und unternehmerisches Denken zu fördern.
Dem inneren Unternehmergeist vertrauen
Intrapreneure kennen die Regeln und umgehen sie wirksam. (…) Um ihre Idee durchzusetzen, machen Intrapreneure nicht an den Grenzen der Organisation halt, sondern legen Regeln flexibel aus, die sie davon abhalten könnten, ihre Ziele zu erreichen.
An zentraler Stelle ihres White-Papers nennen die Autor*innen von Deloitte zwei einprägsame Merksätze. Erstens, „Intrapreneure kann man nicht erschaffen – man muss sie erkennen“. Für die Kanzleien kommt es damit darauf an, Methoden zu entwickeln, um das vorhandene Intrapreneur- Potenzial zu identifizieren und zu heben – verbunden mit der Aufforderung an die Nachwuchskräfte, sich selbstbewusst zu zeigen. Merksatz zwei, „Intrapreneure kennen die Regeln und umgehen sie wirksam. (…) Um ihre Idee durchzusetzen, machen Intrapreneure nicht an den Grenzen der Organisation halt, sondern legen Regeln flexibel aus, die sie davon abhalten könnten, ihre Ziele zu erreichen.“ An dieser Stelle kommt es für Kanzleien darauf an, dem Unternehmergeist im Inneren zu vertrauen – auch dann, wenn die Intrapreneure andere Wege beschreiten. Zumal der Kompass der anwaltlichen Arbeit weiterhin eine klare Richtung vorgibt – eine Richtung, die mit dem im Einklang steht, was sich der Nachwuchs wünscht: Dr. Jörg Schneider-Brodtmann, Partner bei Menold Bezler, nennt als zentrales „Zauberwort bei der Mitarbeitergewinnung und -entwicklung“ den Begriff „Purpose“.
„Dieser Purpose liegt beim Anwaltsberuf primär in der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Kollegen und Kolleginnen, um die Interessen der Mandanten bestmöglich zu fördern.“ Daneben spiele zunehmend die „Möglichkeit, das eigene Arbeitsumfeld mitzugestalten, eine wichtige Rolle“. Wie man bei Menold Bezler diesem Anspruch des Nachwuchses gerecht wird? „Wir binden unsere jungen Anwältinnen und Anwälte nicht nur möglichst frühzeitig direkt in die Mandatsarbeit ein, sondern bieten ihnen in verschiedenen Foren auch Partizipationsmöglichkeiten im Hinblick auf die stetige Fortentwicklung unserer Kanzlei“, sagt Dr. Jörg Schneider- Brodtmann. Kurz: Intrapreneurship braucht Teilhabe – Kanzleien sind gut beraten, den Unternehmergeist im Inneren zu garantieren.
Intrapreneurship – Begriffsklärung und Buchtipp
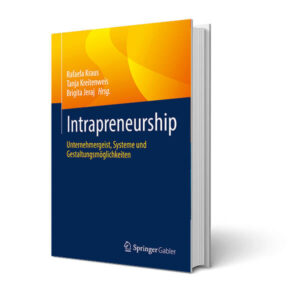 Erstmals erwähnt wurde der Begriff vom „Intrapreneur“ wohl vom US-amerikanischen Unternehmer- Ehepaar Elizabeth Pinchot und Gifford Pinchot III. Im 1978 publizierten Aufsatz „Intra-Corporate Entrepreneurship“ näherten sich die beiden dem Potenzial des unternehmerischen Denkens im Inneren einer Organisation an. In einem Video-Interview mit dem Portal „innov8rs“ definiert Gifford Pinchot III: „Intrapreneure sind die Träumer, die etwas tun. Sie sehen nicht nur die Zukunft, sie unternehmen auch die praktischen Schritte, die notwendig sind, um diese Zukunft zu verwirklichen.“ Wer tiefer in das Thema einsteigen möchte: Das Buch „Intrapreneurship: Unternehmergeist, Systeme und Gestaltungsmöglichkeiten“, herausgegeben von Rafaela Kraus, Tanja Kreitenweis und Brigita Jeraj (Springer Gabler 2022) bietet einen Einblick in den Ansatz.
Erstmals erwähnt wurde der Begriff vom „Intrapreneur“ wohl vom US-amerikanischen Unternehmer- Ehepaar Elizabeth Pinchot und Gifford Pinchot III. Im 1978 publizierten Aufsatz „Intra-Corporate Entrepreneurship“ näherten sich die beiden dem Potenzial des unternehmerischen Denkens im Inneren einer Organisation an. In einem Video-Interview mit dem Portal „innov8rs“ definiert Gifford Pinchot III: „Intrapreneure sind die Träumer, die etwas tun. Sie sehen nicht nur die Zukunft, sie unternehmen auch die praktischen Schritte, die notwendig sind, um diese Zukunft zu verwirklichen.“ Wer tiefer in das Thema einsteigen möchte: Das Buch „Intrapreneurship: Unternehmergeist, Systeme und Gestaltungsmöglichkeiten“, herausgegeben von Rafaela Kraus, Tanja Kreitenweis und Brigita Jeraj (Springer Gabler 2022) bietet einen Einblick in den Ansatz.
 Wir am UKM haben ein Ziel: Wir helfen Menschen, gesund zu werden und gesund zu bleiben – der modernen Hochleistungsmedizin geben wir dabei ein menschliches Gesicht.
Interessiert?
Und das ist noch nicht genug?
Unsere Mitarbeitendenvorteile.
______________________________
UKM | Albert-Schweitzer-Campus 1 | 48149 Münster
Wir am UKM haben ein Ziel: Wir helfen Menschen, gesund zu werden und gesund zu bleiben – der modernen Hochleistungsmedizin geben wir dabei ein menschliches Gesicht.
Interessiert?
Und das ist noch nicht genug?
Unsere Mitarbeitendenvorteile.
______________________________
UKM | Albert-Schweitzer-Campus 1 | 48149 Münster





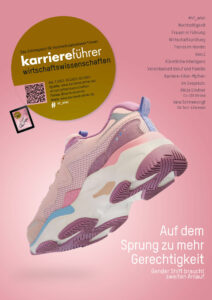



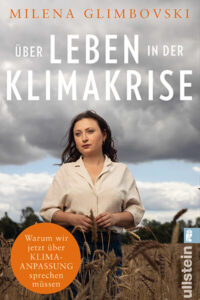 Ansteigende Temperaturen, massive Dürre, extreme Wetterphänomene – die Klimakrise ist längst auch in Deutschland angekommen. Die Trinkwasserversorgung ist nicht mehr sicher, die Landwirtschaft hat es so schwer wie nie zuvor, der Meeresspiegel steigt. Doch selbst wenn die politisch Verantwortlichen die große Katastrophe noch abwenden können: Viele klimatische Veränderungen sind nicht mehr rückg.ngig zu machen. Milena Glimbovski, Aktivistin und Gründerin des ersten Unverpackt-Ladens in Berlin, stellt in ihrem Buch konkrete Maßnahmen vor, die wir politisch, aber auch privat umsetzen müssen, um eine klimaresiliente Gesellschaft zu schaffen. Milena Glimbovski: Das Leben in der Klimakrise. Ullstein Buchverlage 2023. 14,99 Euro Milena Glimbovski veröffentlicht zudem den
Ansteigende Temperaturen, massive Dürre, extreme Wetterphänomene – die Klimakrise ist längst auch in Deutschland angekommen. Die Trinkwasserversorgung ist nicht mehr sicher, die Landwirtschaft hat es so schwer wie nie zuvor, der Meeresspiegel steigt. Doch selbst wenn die politisch Verantwortlichen die große Katastrophe noch abwenden können: Viele klimatische Veränderungen sind nicht mehr rückg.ngig zu machen. Milena Glimbovski, Aktivistin und Gründerin des ersten Unverpackt-Ladens in Berlin, stellt in ihrem Buch konkrete Maßnahmen vor, die wir politisch, aber auch privat umsetzen müssen, um eine klimaresiliente Gesellschaft zu schaffen. Milena Glimbovski: Das Leben in der Klimakrise. Ullstein Buchverlage 2023. 14,99 Euro Milena Glimbovski veröffentlicht zudem den 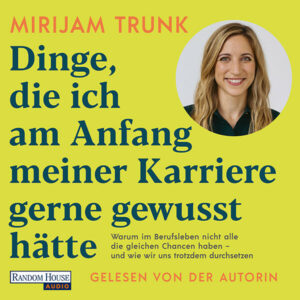 Wir haben im Berufsleben nicht alle die gleichen Chancen, sagt Mirijam Trunk. „Am Tag der Geburt entscheidet sich – je nachdem, wie jemand ausschaut, wo jemand herkommt, welches Geschlecht jemand hat und so weiter – ob diese Person oder mit welcher Wahrscheinlichkeit diese Person es in diesem Land in eine Führungsrolle schafft.“ Mirijam Trunk, 31 Jahre, ist Chief Crossmedia Officer im Führungsteam von RTL sowie Chief Sustainability & Diversity Officer. In ihrem Buch, das zugleich als Hörbuch erschienen ist, schreibt sie darüber, was sie selbst gerne am Anfang ihrer Laufbahn gewusst hätte und wie Frauen typische Karrierehindernisse überwinden können. Mirijam Trunk: Dinge, die ich am Anfang meiner Karriere gerne gewusst hätte. Warum im Berufsleben nicht alle die gleichen Chancen haben – und wie wir uns trotzdem durchsetzen. Pneguin 2023. 22 Euro Hörbuch: Random House Audio. 8h 30min. 20,95 Euro.
Wir haben im Berufsleben nicht alle die gleichen Chancen, sagt Mirijam Trunk. „Am Tag der Geburt entscheidet sich – je nachdem, wie jemand ausschaut, wo jemand herkommt, welches Geschlecht jemand hat und so weiter – ob diese Person oder mit welcher Wahrscheinlichkeit diese Person es in diesem Land in eine Führungsrolle schafft.“ Mirijam Trunk, 31 Jahre, ist Chief Crossmedia Officer im Führungsteam von RTL sowie Chief Sustainability & Diversity Officer. In ihrem Buch, das zugleich als Hörbuch erschienen ist, schreibt sie darüber, was sie selbst gerne am Anfang ihrer Laufbahn gewusst hätte und wie Frauen typische Karrierehindernisse überwinden können. Mirijam Trunk: Dinge, die ich am Anfang meiner Karriere gerne gewusst hätte. Warum im Berufsleben nicht alle die gleichen Chancen haben – und wie wir uns trotzdem durchsetzen. Pneguin 2023. 22 Euro Hörbuch: Random House Audio. 8h 30min. 20,95 Euro.
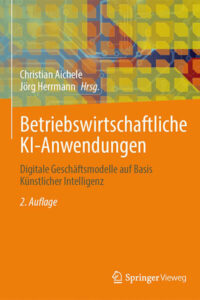 Digitalisierung und Künstliche Intelligenz ermöglichen Unternehmen disruptive Erweiterungen ihrer Geschäftsmodelle. Wer rechtzeitig digitale KI-Geschäftsmodelle einführt, wird seinen Er folg nachhaltig sichern können. Aber wie und wo können solche Modelle Anwendung finden? Diese Publikation gibt Antworten, wo KI-Geschäftsmodelle greifen können, und wie diese von der ersten Idee bis zur produktiven Anwendung realisiert werden können. Christian Aichele, Jörg Herrmann (Hrsg.): Betriebswirtschaftliche KI-Anwendungen. Springer 2023, 64,99 Euro
Digitalisierung und Künstliche Intelligenz ermöglichen Unternehmen disruptive Erweiterungen ihrer Geschäftsmodelle. Wer rechtzeitig digitale KI-Geschäftsmodelle einführt, wird seinen Er folg nachhaltig sichern können. Aber wie und wo können solche Modelle Anwendung finden? Diese Publikation gibt Antworten, wo KI-Geschäftsmodelle greifen können, und wie diese von der ersten Idee bis zur produktiven Anwendung realisiert werden können. Christian Aichele, Jörg Herrmann (Hrsg.): Betriebswirtschaftliche KI-Anwendungen. Springer 2023, 64,99 Euro
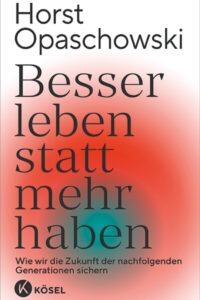 Wirtschaftliches Wachstum gilt als Gradmesser für gesellschaftlichen Fortschritt, für Wohlstand und Zufriedenheit. Doch gerade in unsicheren Zeiten leidet die Konsumlaune und materielle Werte treten zunehmend hinter der Frage zurück, was wirklich zählt im Leben. Prof. Dr. Horst Opaschowski skizziert anhand seiner aktuellsten Studien ein zukunftsfähiges Fortschrittskonzept, in dessen Zentrum wieder das persönliche und soziale Wohlergehen steht. Eine vom Wunsch nach besserem Leben geleitete Wertehierarchie, die auch kontrovers diskutierte Themen wie bedingungsloses Grundeinkommen, soziales Pflichtjahr oder Arbeiten im Alter aufgreift. Horst Opaschowski: Besser leben statt mehr haben. Kösel 2023. 22,00 Euro.
Wirtschaftliches Wachstum gilt als Gradmesser für gesellschaftlichen Fortschritt, für Wohlstand und Zufriedenheit. Doch gerade in unsicheren Zeiten leidet die Konsumlaune und materielle Werte treten zunehmend hinter der Frage zurück, was wirklich zählt im Leben. Prof. Dr. Horst Opaschowski skizziert anhand seiner aktuellsten Studien ein zukunftsfähiges Fortschrittskonzept, in dessen Zentrum wieder das persönliche und soziale Wohlergehen steht. Eine vom Wunsch nach besserem Leben geleitete Wertehierarchie, die auch kontrovers diskutierte Themen wie bedingungsloses Grundeinkommen, soziales Pflichtjahr oder Arbeiten im Alter aufgreift. Horst Opaschowski: Besser leben statt mehr haben. Kösel 2023. 22,00 Euro.

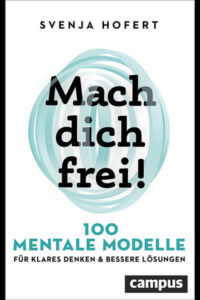 Menschen agieren nach bestimmten mentalen Modellen: Sie machen sich Bilder von der Wirklichkeit, die wiederum die Basis für ihre Handlungen sind – meist ganz unbewusst. Allerdings hat die Realität diese Art zu denken schon längst überholt. Svenja Hofert versammelt in ihrem Buch 100 mentale Modelle, die helfen, die heutige Komplexität zu meistern. Dabei geht es um Erfolg und Führung, Job und Karriere, Lernen und Entwicklung oder Gruppen und Zusammenarbeit. Die Autorin gibt praktische Anregungen, das Denken – auch spielerisch – zu erweitern und zeitgemäße Lösungen für wichtige Fragen unserer Zeit zu finden. Sei es im Beruf, privat, gesellschaftlich oder für Unternehmen. Svenja Hofert: Mach dich frei! 100 mentale Modelle für klares Denken und bessere Lösungen. Campus 2023. 24,00 Euro.
Menschen agieren nach bestimmten mentalen Modellen: Sie machen sich Bilder von der Wirklichkeit, die wiederum die Basis für ihre Handlungen sind – meist ganz unbewusst. Allerdings hat die Realität diese Art zu denken schon längst überholt. Svenja Hofert versammelt in ihrem Buch 100 mentale Modelle, die helfen, die heutige Komplexität zu meistern. Dabei geht es um Erfolg und Führung, Job und Karriere, Lernen und Entwicklung oder Gruppen und Zusammenarbeit. Die Autorin gibt praktische Anregungen, das Denken – auch spielerisch – zu erweitern und zeitgemäße Lösungen für wichtige Fragen unserer Zeit zu finden. Sei es im Beruf, privat, gesellschaftlich oder für Unternehmen. Svenja Hofert: Mach dich frei! 100 mentale Modelle für klares Denken und bessere Lösungen. Campus 2023. 24,00 Euro.
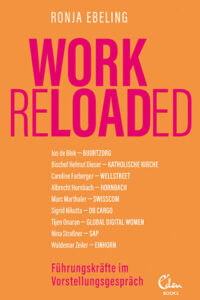 Ronja Ebeling hat zum Vorstellungsgespräch eingeladen: Stellvertretend für die Generation Z hat sie Gespräche mit bekannten Wirtschaftsakteur*innen geführt und und geprüft, ob junge Menschen in der Arbeitswelt überhaupt mitgedacht werden. Sind die namhaften Manager*innen den Anforderungen der jungen Generation gewachsen? Das kann man nun nachlesen: Neun Gespräche hat Ronja Ebeling nun in einem Buch veröffentlicht – hochinteressant und dabei sehr unterhaltsam! Ronja Ebeling; Work Reloaded. Führungskräfte im Vorstellungsgespräch. Eben Books 2023. 17,95 Euro.
Ronja Ebeling hat zum Vorstellungsgespräch eingeladen: Stellvertretend für die Generation Z hat sie Gespräche mit bekannten Wirtschaftsakteur*innen geführt und und geprüft, ob junge Menschen in der Arbeitswelt überhaupt mitgedacht werden. Sind die namhaften Manager*innen den Anforderungen der jungen Generation gewachsen? Das kann man nun nachlesen: Neun Gespräche hat Ronja Ebeling nun in einem Buch veröffentlicht – hochinteressant und dabei sehr unterhaltsam! Ronja Ebeling; Work Reloaded. Führungskräfte im Vorstellungsgespräch. Eben Books 2023. 17,95 Euro. 



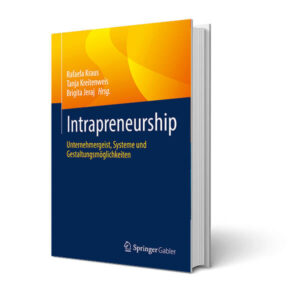 Erstmals erwähnt wurde der Begriff vom „Intrapreneur“ wohl vom US-amerikanischen Unternehmer- Ehepaar Elizabeth Pinchot und Gifford Pinchot III. Im 1978 publizierten Aufsatz „Intra-Corporate Entrepreneurship“ näherten sich die beiden dem Potenzial des unternehmerischen Denkens im Inneren einer Organisation an. In einem Video-Interview mit dem Portal „innov8rs“ definiert Gifford Pinchot III: „Intrapreneure sind die Träumer, die etwas tun. Sie sehen nicht nur die Zukunft, sie unternehmen auch die praktischen Schritte, die notwendig sind, um diese Zukunft zu verwirklichen.“ Wer tiefer in das Thema einsteigen möchte: Das Buch „Intrapreneurship: Unternehmergeist, Systeme und Gestaltungsmöglichkeiten“, herausgegeben von Rafaela Kraus, Tanja Kreitenweis und Brigita Jeraj (Springer Gabler 2022) bietet einen Einblick in den Ansatz.
Erstmals erwähnt wurde der Begriff vom „Intrapreneur“ wohl vom US-amerikanischen Unternehmer- Ehepaar Elizabeth Pinchot und Gifford Pinchot III. Im 1978 publizierten Aufsatz „Intra-Corporate Entrepreneurship“ näherten sich die beiden dem Potenzial des unternehmerischen Denkens im Inneren einer Organisation an. In einem Video-Interview mit dem Portal „innov8rs“ definiert Gifford Pinchot III: „Intrapreneure sind die Träumer, die etwas tun. Sie sehen nicht nur die Zukunft, sie unternehmen auch die praktischen Schritte, die notwendig sind, um diese Zukunft zu verwirklichen.“ Wer tiefer in das Thema einsteigen möchte: Das Buch „Intrapreneurship: Unternehmergeist, Systeme und Gestaltungsmöglichkeiten“, herausgegeben von Rafaela Kraus, Tanja Kreitenweis und Brigita Jeraj (Springer Gabler 2022) bietet einen Einblick in den Ansatz.