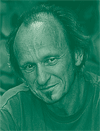Nach einigen Jahren in der Bankenbranche wechselte Dr. Imeyen Ebong ins Consulting – ein Schritt, den er nicht bereut hat. Vom Einstieg als Berater hat er sich zielstrebig zum Partner hochgearbeitet. Mit Sabine Olschner sprach er über Wandelfähigkeit, Karriere und Konkurrenz in der Beraterwelt.
Zur Person
Dr. Imeyen Ebong, 41 Jahre, gehört seit Januar 2005 zum Partnerkreis von Bain & Company in München. Seine Beratungsschwerpunkte liegen im Telekommunikationssektor, der Konsumgüterindustrie sowie auf Organisationsfragen.
1997 wechselte er aus dem Bankensektor, wo er unter anderem bei der Bayern LB gearbeitet hat, zu Bain & Company. Als Consultant hat er zahlreiche Projekte in der Private Equity- Branche, im Telekommunikationsbereich und bei führenden Konsumgüterherstellern verantwortet.
Imeyen Ebong studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Augsburg und promovierte im Fach Wirtschaftssoziologie. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. Zu seinen Hobbys gehören Literatur und Bergwandern in den nahen Alpen.
Sie haben mit BWL ein klassisches Studienfach für die Consultingbranche gewählt. Welche Rolle spielt die Studienrichtung tatsächlich?
Wir bei Bain schauen auf jeden Fall auf das Studienfach. Am liebsten sind uns BWL- und VWL-Absolventen sowie Wirtschaftsingenieure aber auch Wirtschaftsinformatiker, Ingenieurwissenschaftler, Naturwissenschaftler, Mediziner, Juristen und in Ausnahmefällen auch Geisteswissenschaftler. Diese müssen allerdings nachweisen, dass sie sich für wirtschaftliche Themen und Beratung interessieren. Eine Zeitlang haben wir propagiert, dass das Studienfach bei den Bewerbern keine Rolle spielt. Wir mussten aber feststellen, dass es für die Einsteiger ohne Basiswissen in Wirtschaftsthemen schwierig war.
Welche Bedeutung hat ein Doktortitel in der Beratung?
Es macht überhaupt keinen Unterschied, ob man einen Doktor hat oder nicht. Ich selber habe promoviert, weil ich in den Bankenbereich wollte, wo die Promotion eine größere Rolle spielt. In der Beratung steigt man mit einem Doktor zwar eine Stufe höher ein, in der Regel als Berater statt als Juniorberater. Aber Juniorberater erhalten auch die Gelegenheit, nach zwei Jahren eine bezahlte Auszeit zu nehmen, um, wenn sie möchten, zu promovieren, einen MBA zu machen oder sich anderweitig weiterzubilden.
Nach mehreren Jahren in der Bank sind Sie in die Beratung gewechselt. Was hat Sie an der Consultingbranche gereizt?
Nach fünf intensiven, lehrreichen Jahren in der Bankenbranche war ich an einem Punkt angelangt, an dem ich etwas Neues beginnen, neue Themen kennen lernen wollte. Die Beratung bot mir die Chance, sehr schnell viele verschiedene Branchen kennen zu lernen und mich selbst schnell weiterzuentwickeln.
Können Sie angehenden Consultants empfehlen, ebenfalls erst Erfahrung in einer Industriebranche zu sammeln, bevor sie in die Beratung gehen?
Die Erfahrung aus anderen Branchen kann hilfreich sein, wenn sie von kurzer Dauer ist, also rund zwei bis fünf Jahre. Danach ist ein Wechsel schwierig, weil zum einen die persönliche Wandelfähigkeit nachlässt, zum anderen weil der Abstand der Qualifikation zu den erfahrenen Beraterkollegen zu groß wird. Wenn jemand Berater werden möchte, sollte er also so früh wie möglich in die Consultingbranche einsteigen.
Der umgekehrte Weg – erst die Beratung, dann die Industrie – wird häufiger gegangen …
Ja, nach zwei bis fünf Jahren gehen viele in die Industrie, häufig in ein Kundenunternehmen. Wer aber glaubt, ein bis zwei Jahre Beratung qualifizieren automatisch für eine steile Karriere in jedem Unternehmen, der wird sich schwer tun. Denen rate ich, direkt in einem Unternehmen einzusteigen, um dort mit ihrer ganzen Energie vorankommen. Ich meine, grundsätzlich sollten Studenten vor ihrem Abschluss in sich gehen und auf der Basis von Praktika entscheiden, was sie wirklich machen wollen – und den Berufseinstieg weniger als Probierphase sehen. Ich würde es heute, da ich die Beraterbranche kenne, auch anders machen.
Ihre Beratungsschwerpunkte liegen abseits vom Bankensektor. Wie schnell können sich Berater in neue Branchen einarbeiten?
Das ist am Anfang sehr einfach, weil man bewusst über alle Branchen hinweg eingesetzt wird. Später erwarten Kunden dann einen Gesprächspartner, der ihre Themen und ihre Herausforderungen genau kennt. Dieses Know-how erwirbt man sich erst nach mehrjähriger Erfahrung mit einer Branche. Jeder Berater muss im Laufe der Zeit seine Themen entdecken und sie dann auch pflegen und vorantreiben.
Sie sind mit 39 Jahren zum Partner von Bain ernannt worden. Ist das ein typisches Alter?
Grundsätzlich spielt das Alter bei dieser Entscheidung keine Rolle. Allerdings verlangt die Partnerrolle natürlich eine gewisse Erfahrung und Kompetenz im Umgang mit Kunden und bei der Lösung schwieriger strategischer Fragestellungen, die man erst über die Zeit sammelt. Vom Einstieg in die Beratung bis zur Partnerschaft vergehen im Schnitt acht bis zehn Jahre. Wer es bis dahin nicht geschafft hat, verlässt meist die Firma. Beratung ist nämlich ein extrem kompetitives Business …
Also das klassische „Up or Out“ – aufsteigen oder gehen?
Das „Up or Out“ gehört einfach zur Beraterbranche, dessen muss man sich als Einsteiger bewusst sein. Viele lassen sich davon abschrecken. Nicht alle wollen sich halbjährlich einer vollständigen Bewertung unterziehen, die unter Umständen auch negativ ausfallen kann.
Was müssen junge Berater leisten, um Partner zu werden?
Sie müssen wiederholt den Beweis erbringen, dass sie für große Unternehmen schwierige Probleme lösen und neue Kunden akquirieren können. Am Ende des Tages müssen Partner ihre Teams und sich tragen können. Damit ist jeder ein eigenständiges, kleines Profit Center. Darüber hinaus müssen Partner von ihren Teams geschätzt werden und in der Lage sein, ihre Mitarbeiter ohne unnötigen Druck zu Höchstleistungen zu motivieren. Und nicht zuletzt muss man als Person in die bestehende Partnergruppe hineinpassen.
Sie haben drei Kinder. Ist die Beraterbranche eher familienfreundlich oder -feindlich?
Die Arbeit in der Beratung ist sicherlich eine größere Herausforderung für ein geregeltes Familienleben als ein klassischer Acht-Stunden-Job, das lässt sich nicht schönreden. Das liegt an mehreren Faktoren: Die Unternehmen, für die wir arbeiten, werden immer anspruchsvoller, die Beratung damit immer komplexer. Das bedeutet, wir müssen härter und länger arbeiten. Dies lässt sich relativ schwer mit einem idealtypischen Familienbild verbinden. Aber für junge, ambitionierte Menschen, die etwas erreichen wollen, wäre die Situation nicht viel anders, wenn sie in einem Großunternehmen arbeiten würden. Daher heißt das Motto gar nicht mehr so sehr: Beratung oder nicht Beratung, sondern Karriere oder nicht Karriere.
Zum Unternehmen
Mit weltweit 3200 Mitarbeitern in 33 Büros in 21 Ländern zählt Bain & Company zu den großen, global operierenden Strategieberatungen. Im deutschsprachigen Raum arbeiten über 350 Mitarbeiter in den Büros in München, Düsseldorf und Zürich. Die Eröffnung weiterer Büros ist geplant.
1973 in Boston/USA gegründet, gilt Bain als Pionier der ergebnisorientierten, umsetzungsnahen Strategieberatung in allen relevanten Industrie- und Dienstleistungszweigen. Darüber hinaus ist Bain in Europa führend in der Beratung von Private Equity Unternehmen.
Die Stärke der Bain-Berater liegt in der Verbindung von Strategieentwicklung und deren Umsetzung. Zusammen mit den Klienten arbeiten die Berater darauf hin, den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. Dafür akzeptiert Bain auch erfolgsabhängige Honorare.