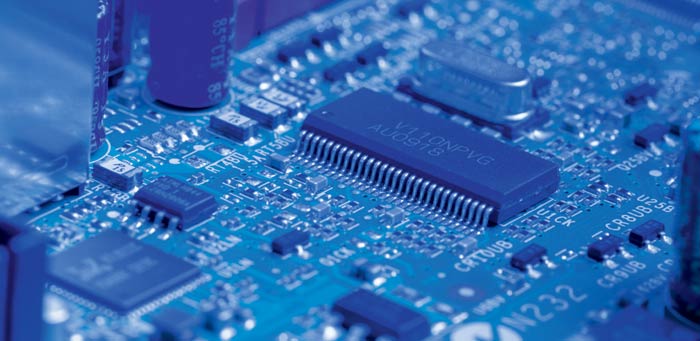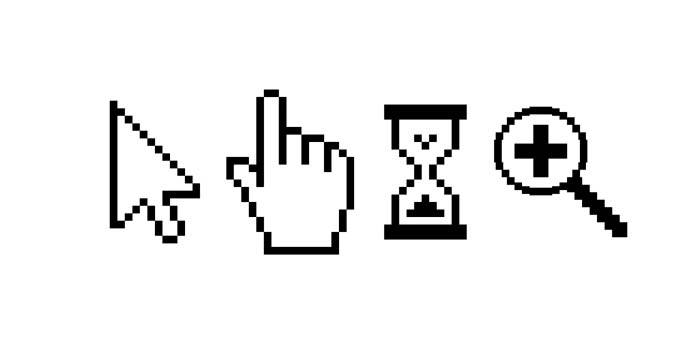Ein Blick in die Vorstände der großen Technikkonzerne zeigt: Die Unternehmen setzen verstärkt auf Ingenieure als Spitzenmanager. Denn wenn es darum geht, technische Prozesse zu verstehen, ist ihr fachliches Know-how Gold wert. Doch ohne Führungsqualitäten und Wirtschaftswissen geht es nicht. Wer einen MBA draufsattelt weiß, wie Management funktioniert und was moderne Führung auszeichnet. Von André Boße
Die Spitzenpositionen in den deutschen Unternehmen sind nicht den BWLern und Juristen vorbehalten. Daimler-Chef Dieter Zetsche ist studierter Elektrotechniker. Martin Winterkorn, erster Mann bei Volkswagen, studierte Metallkunde. Lufthansa-Vorstandsvorsitzender Carsten Spohr ist Wirtschaftsingenieur. Bosch-Boss Volkmar Denner Physiker.
Vier Beispiele aus den deutschen Chefetagen, und was dort an der Spitze erkennbar ist, setzt sich auf den niedrigeren Managementebenen fort: Die Vorstellung, nach der Ingenieure in den Unternehmen Fachkarrieren starten und im Management von den BWL-Kollegen überholt werden, stimmt nicht mehr. Bei Siemens in Deutschland liegt der Anteil der Positionen mit Projekt- oder Personalverantwortung, die von Ingenieuren wahrgenommen werden, bei mehr als 50 Prozent. Auf globaler Ebene liegt die Konzernquote übrigens bei 40 Prozent – ein Zeichen dafür, dass Ingenieure in Deutschland besonders häufig den Weg ins Management finden. Und auch beim Autobauer Audi liegt der Anteil der Ingenieure auf den Führungsebenen bei knapp 50 Prozent.
MBA – wo kommt das eigentlich her?
In den USA und Großbritannien zählt der Master of Business Administration (MBA) schon seit mehr als 100 Jahren zu den Standardabschlüssen an den Universitäten. In Deutschland etablierte erstmals die Universität Saarbrücken im Jahr 1990 einen MBA-Studiengang, damals noch mit starker internationaler Ausrichtung. Heute wird der MBA von vielen Hochschulen angeboten, darunter Business Schools aber auch klassische Hochschulen. Er
zählt in Deutschland zu den Weiterbildungsstudiengängen, daher werden in der Regel Studiengebühren erhoben.
Linktipp
Einen Überblick über Anbieter bietet das Internetportal www.mba-studium.net.
Ingenieur mit Business-Know-how
Das sind beachtliche Zahlen, wobei weiterhin gilt: Egal, wie gut das technische Know-how ist, ohne Managementqualifikationen funktioniert der Aufstieg nicht. Im Gegenteil: So sehr die Unternehmen Ingenieure in Führungspositionen schätzen, so sehr legen sie auch Wert darauf, dass die Ingenieure verstehen, was Führung bedeutet – und dass sie diese Fähigkeiten auch anwenden können. „Die Anforderungen beschränken sich dabei nicht nur auf fundierte Fachkenntnisse, sondern in zunehmendem Maße auf Führungsfähigkeiten“, erläutert Marion Käser-Seitz, geschäftsführende Gesellschafterin der Personalberatung QRC, die sich auf Ingenieure fokussiert. Käser-Seitz geht sogar so weit zu sagen: „Ein Ingenieur, der keine Führungsfähigkeiten mitbringt, ist international praktisch nicht wettbewerbsfähig – und sei es auch für eine exponierte Fachfunktion.“
Aber was genau macht Ingenieure in Führungspositionen so begehrt? Warum gehen Unternehmen nicht den leichteren Weg und holen sich BWLer, die alle wichtigen Führungsqualifikationen bereits an der Universität gelernt haben? Die Frage geht an Audi, wo Ralph Linde, Geschäftsführer der unternehmenseigenen Audi Akademie, eine schnelle Erklärung findet. „Wir sind ein technisches Unternehmen und in diesem Bereich auf hohe fachliche Kompetenz angewiesen. Nur wer die Themen und Abläufe sehr gut kennt, hinterfragt Dinge und versucht, sie zu optimieren.“ Ähnlich argumentiert Nicole Herrfurth, die bei Siemens den Bereich Leadership Development leitet und im Konzern die Auswahl der Führungskräfte weltweit verantwortet: „Eine Führungskraft mit Ingenieurhintergrund kann bei technischen Fragestellungen mit den Technikern und Ingenieuren auf Augenhöhe diskutieren.“ Dieses Verständnis für technische Prozesse und technisches Denken ist es, was Unternehmen dazu bringt, Ingenieure zunehmend in das Management zu übernehmen. Dabei setzen sie verstärkt auch auf methodische Kompetenzen, die bei Ingenieuren seit jeher besonders stark ausgeprägt sind. „Vom Studium her ist es der Ingenieur gewohnt, strukturiert vorzugehen und Themen sachlich und zielorientiert voranzutreiben“, sagt Ralph Linde. „Das sind Eigenschaften, die im Führungsalltag helfen können.“
Ingenieure punkten bei Kommunikation
Auch bei Lufthansa Technik, der auf Ingenieurdienstleistungen spezialisierten Tochter der größten deutschen Fluglinie, stehen Ingenieure wegen ihres originären Know-hows als Führungspersönlichkeiten hoch im Kurs. „Wir sind ein Unternehmen, das stark durch technische Prozesse geprägt ist, wobei Ingenieure in der Regel eine große persönliche Nähe zu unserem Kernprodukt aufweisen“, sagt Peter Schürholz, Leiter Personalmarketing und Talent Relationship Management. Diese Nähe ist einerseits wichtig, um die richtigen fachlichen Entscheidungen zu treffen. Andererseits hilft sie dabei, einen Bereich der Führung zu gestalten, der besonders wichtig ist: die Kommunikation.
Glaubt man dem Klischee, dann sind Ingenieuren die Kommunikationsfähigkeiten nicht in die Wiege gelegt worden – zumal es im Studium häufig um andere Aspekte geht als um die freie Rede, motivierende Ansprachen oder Verhandlungsgeschick. Doch für Peter Schürholz haben Ingenieure gegenüber den Kollegen anderer Fachrichtungen einen großen Vorteil: Jede Führungskraft müsse in der Lage sein, angemessen mit den Kollegen des sogenannten Shop-Floors zu kommunizieren, also dort, wo körperlich gearbeitet wird – und das können Ingenieure. „In den Werkstätten und Flugzeughallen herrscht zuweilen ein etwas rauerer Ton. Damit muss die Führungskraft klarkommen. Sie muss sich den Respekt, die Wertschätzung und die Anerkennung der Mechaniker, Vorleute und Meister erst einmal verdienen – und dies fällt Führungskräften mit einem Ingenieurhintergrund unter Umständen leichter als einem BWLer.“
Manager im Blaumann
In der modernen Führung ist Authentizität ein besonders wichtiger Aspekt. Mitarbeiter wollen glaubwürdige Vorgesetzte, die Orientierung geben und Perspektiven entwickeln. Und hier besitzen Ingenieure in technisch geprägten Unternehmen durchaus einen Vorteil, weil sie die Sprache verstehen und die Materie kennen. So werden Managementtrainees – ob mit oder ohne Ingenieurhintergrund – nach ihrem Einstieg zunächst einmal auf einen drei Wochen langen Lauf durch das Unternehmen geschickt. „Hierzu gehört auch, dass sie sich den Blaumann überziehen, sich morgens um sechs Uhr im Meisterbüro melden und dann eine Frühschicht mitlaufen“, beschreibt Schürholz. Wem man in dieser Situation anmerkt, dass er zum ersten Mal in seinem Leben Arbeitskleidung trägt und dass er seinen für die Business School gekauften Anzug nur sehr widerwillig in den Spind hängt, kommt bei den Leuten in den Werkstätten nicht sehr authentisch rüber.
Ingenieure haben also gute Karten. Doch die Ansprüche an erfolgreiche Karrieren sind hoch. Bei Siemens achten die Personaler bei den Führungskräften „auf eine starke Ergebnis- und Kundenorientierung, strategisch-innovative Fähigkeiten, eine teamorientierte Zusammenarbeit und interkulturelle Sensibilität“, so Nicole Herrfurth. Diese Feinfühligkeit ist auch bei Audi ein zentraler Begriff der Führungsarbeit. „Wichtig ist das Verständnis für das Menschliche, für soziale Beziehungen“, definiert der Personalverantwortliche Ralph Linde. „Es braucht zudem die Toleranz, dass jeder Mensch individuell und verschieden ist.“ Was Führung heute auszeichnet, sei die Erkenntnis, dass es nicht einen Stil gibt, der für alle Mitarbeiter passt. Flexibilität und Empathie sind angesagt. „Deshalb“, so Linde, „ist es wichtig, die eher naturwissenschaftliche und technische Sichtweise eines Ingenieurs um eine sozialwissenschaftliche, auf den Menschen fokussierte zu erweitern.“
Coachings für Führungsnachwuchs
Ein Beispiel aus dem Alltag bei Lufthansa Technik: Wenn die Konzernmutter Lufthansa ein Flugzeug an ihre Tochter übergibt, möchte sie es möglichst schnell zurückhaben – schließlich können Flugzeuge nur Geld erwirtschaften, wenn sie in Betrieb sind. Wartet oder repariert die Lufthansa Technik ein Flugzeug oder stattet sie es neu aus, tickt im Hintergrund also immer die Uhr mit. „Diese Rahmenbedingungen erfordern von den Führungskräften hohe Belastbarkeit und Flexibilität“, sagt Peter Schürholz. „Die meisten Aufgaben sind projekthafter Natur – daher sind entsprechende Fähigkeiten im Projektmanagement unverzichtbar.“
Der Weg in Führungspositionen erfolgt für Ingenieure in der Regel zunächst einmal über kleinere Projekte. „Man startet mit der Führung von Teams und erhält mit der gewonnenen Erfahrung mehr Verantwortung“, beschreibt die Siemens-Personalerin Nicole Herrfurth den Weg. Um den Ingenieurnachwuchs fit für die Führung zu machen, bieten die Unternehmen in der Regel eigene Schulungen, wobei ambitionierte Einsteiger darauf achten sollten, dass die Arbeitgeber bei diesen Fortbildungen das einhalten, was sie auch von ihren Führungskräften verlangen: Genauso wenig, wie es den einen universellen Führungsstil gibt, darf man es bei der Fortbildung nicht bei Standardschulungen belassen. „Wir bieten daher eine Vielzahl von Kursen“, sagt Nicole Herrfurth. „Dabei haben wir je nach Situation unterschiedliche Trainings im Angebot, denn: Mitarbeiter, die ganz neu eine Führungsposition übernehmen, haben andere Fragen als langjährige Führungskräfte, die ganze Bereiche leiten.“
Ethik im Fokus
Ist die erste Führungsposition erreicht, beginnt für die Ingenieure in den Unternehmen eine sensible Zeit. Vorgesetzter zu sein, zudem mit MBA-Abschluss, ändert den eigenen Status. Der Einfluss im Unternehmen steigt, die höhere Position verleiht Macht. Es ist nicht immer einfach, damit umzugehen, weshalb es für Ingenieure in Führungspositionen besonders wichtig ist, weiterhin engen Kontakt zur Basis zu halten. „Keine Führungskraft weiß mehr als die Summe ihrer Mitarbeiter“, sagt Audi- Personaler Ralph Linde. Dennoch müsse man auch in der Lage sein, unpopuläre Entscheidungen zu treffen und umzusetzen. „Führung ist daher immer eine Gratwanderung zwischen Beteiligung und eigener Entscheidung.“ Ein konkreter Aspekt ist hier die Frage nach einer guten Work-Life-Balance – für das Team, aber auch für die Führungskraft selbst. „Die eigene Fitness sowie ein erfülltes Arbeits- und Privatleben sind Voraussetzungen für gute Leistung. Innerhalb des Teams für diese Balance zu sorgen, heißt auch, verantwortlich zu handeln“, sagt Ralph Linde. Sobald die Macht ins Spiel kommt, stellen sich auch ethische Fragen. Wer über ein herausragendes technisches Fachwissen verfügt, denkt oft darüber nach, was technisch alles möglich ist. Für Ingenieure in Führungspositionen ist es jedoch wichtig, immer auch zu hinterfragen, ob das, was machbar ist, auch das ist, was für das Unternehmen gut ist. Und zwar nicht nur aus ökonomischer Sicht, sondern auch mit Blick auf die Werte, für die das Unternehmen steht. Für Peter Schürholz von Lufthansa Technik ist es daher wichtig, dass bei den Führungskräften eine „hohe Übereinstimmung zwischen eigenen Werten und Unternehmenskultur herrscht“.
Doch wie findet man nun einen persönlichen Führungsstil, der zum Unternehmen passt? Audi-Personaler Ralph Linde gibt Einsteigern folgenden Tipp: „Das beste Modell, Führung zu erleben, ist der eigene Vorgesetzte. Läuft alles gut, ist er ein Vorbild, an dem man sich orientieren kann. Wenn nicht, kann man versuchen, alle negativen Erfahrungen in der eigenen Führungsverantwortung nicht zu wiederholen.“
Buchtipps
Eine Vielzahl von Büchern beschäftigt sich mit modernen Führungsstilen und wichtigen Qualitäten. Empfehlenswert für Fortgeschrittene ist „Führen mit flexiblen Zielen“ des Autors Niels Pfläging (Campus 2011), der sich von üblichen Managementpositionen verabschiedet und neue Ansätze für die Führung formuliert. Gezielt an Ingenieure richtet das Buch „Ingenieure an die Schalthebel: Mit den Fähigkeiten der ,Komplexkönner’ zu unternehmerischen Spitzenleistungen“ (Linde 2014). Noch Managementlaie mit knappem Zeitbudget? Kein Problem: „Der 5-Minuten-Manager“ von James McGrath (Börsenmedien 2014) bietet kurze, leicht verdauliche Häppchen für den Einsteiger.