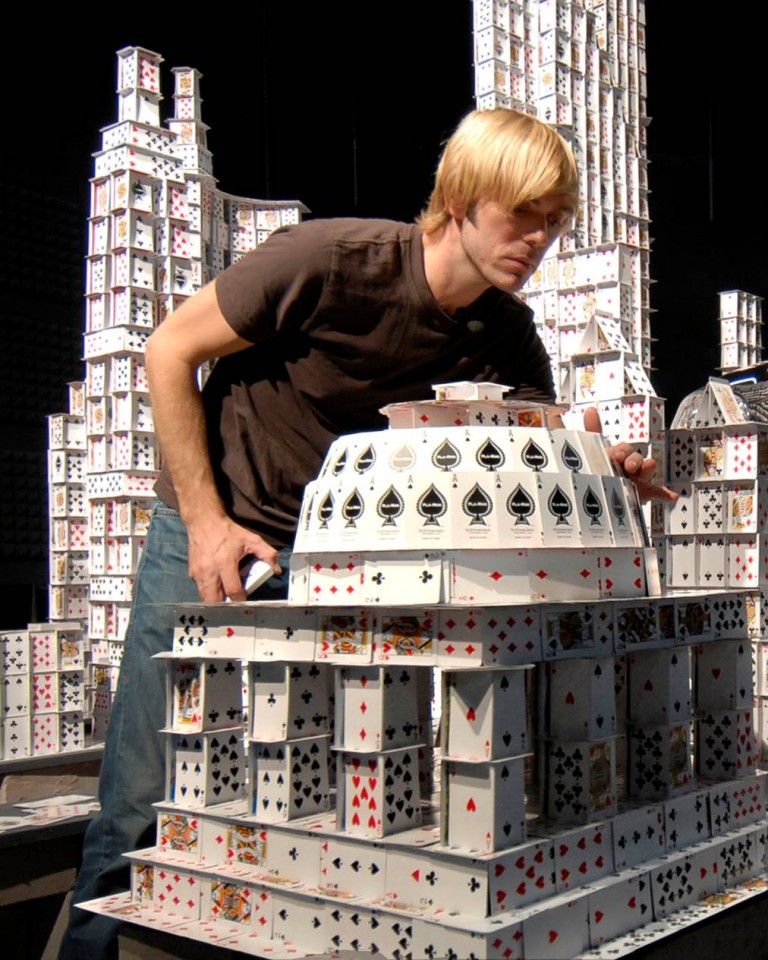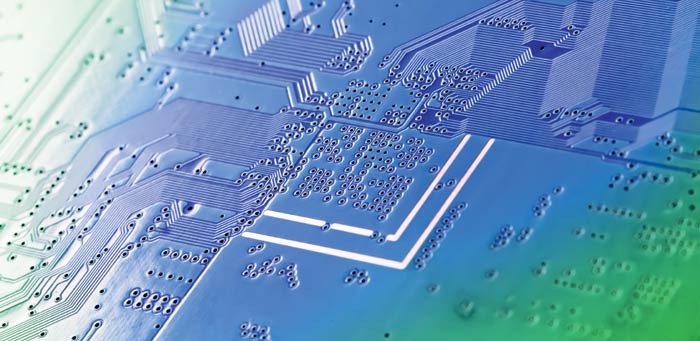Jan Brecht von Adidas zählt zur neuen Generation der CIOs. Er sieht die IT in modernen Unternehmen als wichtigen Businesstreiber, um neue Geschäftsfelder zu etablieren. Kurz: Der 42-Jährge will helfen, dass sein Konzern mehr Geld verdient. Wie das funktionieren kann und was er unter dem Profil eines „Rainmaking CIOs“ versteht, erzählt er im Interview. Die Fragen stellte André Boße.
Zur Person
Jan Brecht studierte von 1992 bis 1995 Elektrotechnik in Karlsruhe und hat einen Masterabschluss in Electro Engineering, den er im britischen Southampton absolvierte. Seine berufliche Karriere begann bei Daimler, wo er zuletzt als CIO Americas für die IT des Autobauers in Nord- und Südamerika verantwortlich war. Nach zwölf Jahren verließ er den Konzern und wechselte 2009 als CIO zur Adidas Gruppe. Bei den sogenannten Skip-Level-Lunches trifft sich der 42-Jährige mit Nachwuchskräften und Mitarbeitern, um in kleiner Runde Themen zu besprechen, die sein IT-Team beschäftigen.
Herr Brecht, Sie gelten als ein „Rainmaking“-CIO. Können Sie uns kurz erläutern, was das bedeutet?
Ein „Rainmaking“-CIO ist jemand, der sich nicht nur auf die Stabilität der Systeme und die Effizienz der Prozesse konzentriert, sondern sich auch dafür einsetzt, Umsatz und Marge zu erhöhen.
Wie kommt es, dass sich die IT heute verstärkt auch als Businesstreiber für die Unternehmen erweist?
Das ergibt sich aus der Reife und den Möglichkeiten der Technologie. Der Fortschritt ist wirklich rasant, und wer als IT-Experte die richtigen Ambitionen hat, findet diverse Chancen, daran zu arbeiten, dass das Unternehmen mehr Gewinn macht.
Wo gelingt Ihnen das bei Adidas besonders gut?
Sicherlich zum Beispiel bei unserer E-Commerce-Plattform, einem technisch getriebenen Geschäftsmodell, das wir weltweit eingeführt haben. Unsere Kunden haben dort unter anderem die Möglichkeit, ihre eigenen Schuhe zu konfigurieren – ein Business- Tool, das vor einigen Jahren noch nicht möglich gewesen wäre. Den Umsatz der Plattform können Sie sehr einfach messen, und es zeigt sich, dass wir hier erfolgreich sind.
Ihre IT-Experten sind demnach auch Gestalter virtueller Verkaufsräume?
Das kann man so sagen, ja. Wobei wir hierbei auf zwei Aspekte achten. Zum einen auf den Umsatz, klar. Aber eben nicht nur. Wir fokussieren uns immer auf unsere Marken, die wir langfristig stärken möchten. Es geht also nicht alleine darum, schnell viel Geld umzusetzen.
Worauf kommt es an, wenn man für ein Unternehmen eine passende IT-Strategie finden und umsetzen möchte?
Beim Finden der Strategie gibt es in unseren Augen drei entscheidende Faktoren: Erstens müssen Sie die Mitarbeiter verstehen. Zweitens müssen Sie die Kunden verstehen – in unserem Fall sowohl die Handelspartner wie Karstadt oder Footlocker als auch die Endkunden, die letztlich unsere Produkte tragen. Drittens kommt es auf ein intaktes IT-Ökosystem an, also darauf, technische Trends zu setzen und auch die Prozesse sowie Zusammenhänge im Unternehmen zu optimieren. Zusammenfassen kann man die Anforderung an unsere IT-Strategie wie folgt: „Bauen Sie ein digitales Ökosystem für den begeisterten Verbraucher und den befugten Mitarbeiter.“
Man kennt Ökosysteme eher aus der Biologie. Warum haben Sie diesen Begriff gewählt?
Weil er neben den technischen Neuerungen für einen bedeutsamen Fortschritt der IT steht. Die traditionelle IT hat Punktlösungen angeboten, zum Beispiel für die Organisation des Vertriebs, der Logistik oder des Controllings. Ich denke jedoch, dass Sie die wirkliche Kraft der IT erst dann entfalten, wenn Sie innerhalb des Unternehmens Zusammenhänge herstellen. Wir als IT-Abteilung sollten diese Möglichkeit nutzen, da wir mit allen anderen Unternehmensbereichen zusammenarbeiten und daher in der Lage sind, ein solches System zu gestalten. Das ist für unsere IT-Spezialisten durchaus anspruchsvoll, weil wir heute nicht mehr nur lokal Dinge optimieren, sondern immer das große Ganze im Blick haben, nämlich das Unternehmen, das sich wie ein Organismus stetig wandelt.
Nun ist eine gute IT-Strategie das eine, aber wie gelingt die Umsetzung?
Ganz einfach: Sie brauchen dafür die richtigen Leute.
Was zeichnet diese aus?
Wenn wir über das Unternehmen als Ökosystem sprechen, ist es wichtig, möglichst alle Bereiche dieses Systems zu kennen und zu verstehen. IT-Experten müssen heute auch begreifen, wie Marketing funktioniert und worauf es in der Logistik ankommt. Es ist offensichtlich, dass die IT damit immer mehr Aufgaben erhält. Daher ist es wichtig, genau zu kommunizieren, welche Aufgaben wir als IT eben nicht mehr übernehmen können.
Zum Beispiel?
Wie alle großen Unternehmen verfügen wir über einen großen Fuhrpark und müssen daher Tankkarten managen und Reisekosten abrechnen. Das sind zwar wichtige, aber keine strategischen Aufgaben. Und wenn sie sich als IT-Abteilung strategisch verstehen, muss man den Mut haben, der Unternehmensführung klarzumachen, dass der IT-Support für solche Aufgaben ausgelagert werden sollte.
Die Mitarbeiter von Adidas sind vergleichsweise jung. Welche besonderen Bedürfnisse von ihnen muss man als IT-Spezialist im Blick haben?
Zum einen sind jüngere Mitarbeiter in der Regel gewohnt, mit Tablets und Smartphones umzugehen, also mit Geräten, die darauf getrimmt sind, dass man sie intuitiv nutzt. Damit steigt der Anspruch an die IT, auch im Unternehmen Systeme bereitzustellen, die intuitiv bedient werden können, sodass klassische Handbücher und IT-Trainings aus dem Unternehmensalltag verschwinden. Ein zweiter Punkt: Noch vor fünf Jahren habe ich als CIO im Unternehmen die kostengünstige Anschaffung von Standard-PCs durchgedrückt. Heute offerieren wir das Prinzip „Bring your own device“. Ich bin der Meinung, dass man bei einer jungen Mitarbeiterschaft mehr davon hat, bei der Hardware eine Flexibilität zuzulassen. Das verursacht zwar unter Umständen höhere Kosten. Jedoch steigt auch die Produktivität, weil die Leute auf der Hardware ihrer Wahl besser arbeiten. Ein dritter Punkt: Wir haben vor einiger Zeit das Intranet neu gestaltet, sodass unsere Leute heute auf dieser Plattform geschäftliche Dinge so kommunizieren können, wie sie es bei privaten Social-Media-Aktivitäten gewohnt sind.
Sie sorgen also dafür, dass sich Ihre Mitarbeiter bei der Nutzung der IT beinahe wie zu Hause fühlen?
Exakt. Dabei freut es uns, wenn sich die Leute wohlfühlen und dadurch ihre Produktivität steigt.
Mit Blick auf diese vielen neuen Herausforderungen für eine „Rainmaking“-IT: Welche Fähigkeiten wünschen Sie sich bei Ihren Nachwuchskräften?
Was wir brauchen, sind Leute, die Themen erfolgreich umsetzen können – und zwar auch gegen Widerstände. Gerade in einem Bereich wie der IT, in dem die Komplexität ständig zunimmt, sind Mitarbeiter mit Kompass gefragt, die wissen, wo ihr Nordstern ist, und sich mit Blick auf dieses Ziel nicht vom Weg abbringen lassen.
Zum Unternehmen
Der deutsche Sportartikelhersteller Adidas hat seinen Stammsitz im fränkischen Herzogenaurach und vereint unter seinem Dach die Marken Adidas, Reebok und TaylorMade. Mit mehr als 50.700 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert die Gruppe mehr als 650 Millionen Produkte pro Jahr. In der Zentrale in Herzogenaurach arbeiten mehr als 3700 Beschäftigte. Die Belegschaft ist international und jung: Das Durchschnittsalter liegt weltweit bei 31 Jahren, im Hauptsitz bei 37 Jahren. Für IT-Spezialisten bietet das Unternehmen neben klassischen Karrieremöglichkeiten als Führungskraft mit Personalverantwortung auch Expertenlaufbahnen.