Alisha Andert ist Juristin und Co-Gründerin und Inhaberin der Innovationsberatung This Is Legal Design. Sie ist spezialisiert auf Legal Design, eine interdisziplinäre Arbeitsweise, die Recht und Design vereint. Ziel ist es, den Herausforderungen der Digitalisierung kompetent zu begegnen und die juristische Methodik zu modernisieren. 2021 wurde Alisha Andert mit dem Digital Female Leader Award ausgezeichnet. Im Interview mit André Boße erzählt die 31-jährige, warum in ihrer Agentur so viele Frauen arbeiten und welche Erfahrungen sie selbst bei der Arbeit in großen Kanzleien gemacht hat.
Zur Person
Alisha Andert, Jahrgang 1990, studierte von 2010 bis 2016 Jura an der Uni Potsdam sowie an der Uni Amsterdam. Nach dem Referendariat in Berlin startete sie 2019 ihre Karriere als Head of Legal Innovation beim Flugentschädigungs-Anbieter Flightright, von 2019 bis 2021 war sie als Head of Legal Innovation in der Kanzlei Chevalier tätig. Sie ist Co-Gründerin und Partnerin der 2018 gegründeten Innovationsberatung This Is Legal Design. Als Volljuristin und am Hasso-Plattner-Institut ausgebildete Design Thinkerin liegt ihr Fokus auf der Entwicklung nutzerzentrierter Produkte und Dienstleistungen für den Rechtsbereich. Seit 2020 ist sie Vorstandsvorsitzende des Legal Tech Verbandes Deutschland, im vergangenen Jahr erhielt sie den Digital Female Leader Award 2021.
Frau Andert, was beim Blick auf das Team, das Sie auf der Homepage Ihrer Legal Design Services-Agentur vorstellen, auffällt: aufgeführt sind acht Juristinnen, nur ein Jurist. Ist das ein Statement?
Wäre es ein Statement, dann würde es voraussetzen, dass wir das so geplant hätten, um eine Message zu setzen. So war es aber nicht. Unser Team hat sich organisch so zusammengesetzt – wobei es aber auch nicht zufällig so gekommen ist, dass sich unter den Initiativbewerbungen sehr viele Frauen befinden.
Woran liegt das?
Wir sind als ein von Frauen geführtes Unternehmen des Rechtsmarkts ein Beleg für die These „why representation matters“: Co-Gründerin Lina Krawietz und ich zeigen uns nach außen sichtbar. Junge Frauen fühlen sich davon angesprochen, weil sie annehmen dürfen, bei uns einen Ort zu finden, an dem sie sich wohlfühlen können. Aus dieser Situation ergibt sich für uns eine Art umgekehrtes Diversity-Problem: Wir wissen natürlich, dass vielfältig besetzte Teams besser performen, weshalb wir uns über männliche Bewerbungen freuen.
Ein Luxusproblem, oder?
Absolut, zumal wir auf eine Branche treffen, die so männerdominiert ist, dass wir als reines Frauenteam bei Kundenaufträgen in der Regel gerade mal in der Lage sind, das Geschlechterverhältnis auszugleichen.
Es gibt einen großen Hunger nach Wandel.
Abseits Ihrer Repräsentanz: Welche Themen bieten Sie Jurist*innen, die für die junge Generation interessant sind?
Wir gelten als eine Art Disrupter, indem wir Kanzleien und Rechtsabteilungen dabei unterstützen, Prozesse, Services und Produkte anders, digitaler und nutzerfreundlicher zu gestalten – und es eben nicht weiter so zu machen, wie es immer schon gemacht worden ist. Wir spüren, wie die junge Generation es genießt, mit diesem Fokus zu arbeiten. Es gibt einen großen Hunger nach Wandel. Wir haben alle in unserem Jurastudium gelitten – ein Studium, das weiterhin ohne jegliche Anbindung an andere Disziplinen stattfindet. Was für einen Bereich wie das Recht, der mitten im Leben der Menschen steht, überhaupt keinen Sinn ergibt.
Sie haben selbst in einer großen Kanzlei gearbeitet, welche Erfahrungen haben sie dort gemacht?
Auch hier: Einen großen Wunsch nach Veränderung. Angestoßen von der Digitalisierung des Rechtsmarktes, also Legal Tech. Es ist schon auffällig, dass dieses Thema insbesondere von der jungen Generation vorangetrieben wird. Das zeigt sich schon daran, dass es an den Universitäten die Studierenden sind, die eine Vielzahl von Legal Tech-Initiativen ins Leben rufen, weil sie sich sagen: „Wir leben in einer digitalen Welt, wir leben einen digitalen Lifestyle – und kommen dann in Strukturen bei Kanzleien, Rechtsabteilungen oder Rechtschutzversicherungen, wo dieses digitale Jahrhundert immer noch nicht begonnen hat.“ Die junge Generation der Jurist*innen hat große Lust, das zu ändern.
Erzeugt dieser Wunsch nach Wandel einen Druck, der die oberen hierarchischen Ebenen erreicht?
Es ist einerseits nicht einfach, von unten Dinge in Bewegung zu setzen. Andererseits ist es nicht überall so, dass es auf den höheren Ebenen generell an Interesse fehlt, Dinge zu verändern. Es gibt sehr viel Partner*innen, die sehr innovativ denken. Grundsätzlich ist es aber schon so, dass diejenigen, die heute einsteigen, mit ihren Bedürfnissen einen Druck aufbauen, den die Kanzleien auch spüren. Wobei dieser Druck vor allem beim Recruiting entsteht. Fast alle Kanzleien verzeichnen ein Nachwuchsproblem, das diverse Gründe hat. Zum einen ist die Generation Y, zu der ich ja auch zähle, zahlenmäßig eine eher kleine Generation, die rein quantitativ die Weggänge der großen Generation der Babyboomer gar nicht auffangen kann. Verschärfend kommt hinzu, dass die großen Kanzleien für die Generation der jungen Jurist*innen nicht mehr so attraktiv sind, wie sie es einmal waren.
Mehr noch als die Generation Y sucht die Generation Z nach einer Arbeit, die sich mit ihren Lebensentwürfen deckt. Dazu gehört es, Beruf und Freizeit sowie später die Familie in Einklang zu bringen.
Woran liegt’s?
Es liegt zum Beispiel an alternativen Arbeitgebern, die als sicherer und durchaus auch als weniger stressig gelten, dazu zählen zum Beispiel die Rechtsabteilungen in Unternehmen oder Verbänden. Was einigen – nicht allen – Kanzleien als einzige Antwort auf dieses Nachwuchsproblem einfällt, sind absurd hohe Gehälter bereits für Einsteiger*innen. Das Problem ist nur, dass die Generation, die aktuell gefragt ist, anders auf die Arbeit blickt. Mehr noch als die Generation Y sucht die Generation Z nach einer Arbeit, die sich mit ihren Lebensentwürfen deckt. Dazu gehört es, Beruf und Freizeit sowie später die Familie in Einklang zu bringen. Auch Purpose ist ein großes Thema: Die junge Generation verlangt nach einer Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit, gerade mit Blick auf Aspekte wie Klimaschutz oder Gerechtigkeit. Es ist offenkundig, dass es insbesondere der Nachwuchs ist, der das Thema Purpose in den großen Kanzleien einführt. Die Arbeitgeber merken dadurch: Geld allein macht uns nicht attraktiv genug, wir müssen einiges darüber hinaus bieten.
Was bedeutet dieses Denken für die Geschäftsmodelle des Rechtsmarkts?
Weiterhin üblich ist die Honorierung rechtlicher Leistungen nach Stundensätzen. Das wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren wohl so bleiben, was vor allem daran liegt, dass dieses traditionelle Billable-Modell weiterhin sehr gut funktioniert. Der wirtschaftliche Druck auf die Kanzleien ist also längst nicht so hoch wie der Druck, Nachwuchs zu recruiten.
Wobei das eine mit dem anderen zusammenhängt.
Absolut, weshalb ich davon ausgehe, dass sich Schritt für Schritt andere Bezahl-Konzepte durchsetzen werden, wiederum auch angetrieben vom Purpose-Gedanken: Viele junge Menschen legen Wert darauf, danach bezahlt zu werden, wie viel Nutzen sie für den Kunden oder die Kanzlei erbringen. Dieser Nutzen liegt nicht allein darin, wie viele Stunden man auf einem Mandat abgerechnet hat. Es passt nicht zum Selbstbild der Generationen Y und Z, nur danach bewertet zu werden, wobei die Generation Z ein noch mal höheres Anspruchsdenken mit Blick auf ihren Arbeitgeber hat. Wohlgemerkt nicht, was das Geld betrifft. Sondern was die Ausgestaltung und die Sinnhaftigkeit der Arbeit betrifft.
Viele junge Menschen legen Wert darauf, danach bezahlt zu werden, wie viel Nutzen sie für den Kunden oder die Kanzlei erbringen. Dieser Nutzen liegt nicht allein darin, wie viele Stunden man auf einem Mandat abgerechnet hat.
Sie sprachen eben über die Eigenarten des Jura-Studiums, in dessen Verlauf man wenig bis gar keinen Kontakt zu anderen Disziplinen erhält. Warum muss sich das dringend ändern?
Weil ich eine Rechtsdienstleistung in der digitalen Gesellschaft als Produkt betrachte, das sich auf einem Markt zu behaupten hat. Nehme ich das ernst, geht überhaupt kein Weg daran vorbei, neben den juristischen Aspekten auch über Marketing, Kommunikation oder IT nachzudenken. Nur so wird es mir gelingen, meine juristische Expertise in ein verständliches und für alle potenziell Interessierten zugängliches Produkt zu transformieren. Das betrifft zum Beispiel die Sprache: Als Nutzerin einer rechtlichen Dienstleistung möchte ich nicht den juristischen Jargon miteinkaufen, im Gegenteil, damit möchte ich bitte nichts zu tun haben.
Bedeutet dieser bessere Zugang auch, dass sich mehr Menschen juristische Services einholen können, als dies bislang der Fall ist?
Absolut. Bislang ist der Gang zum Anwalt vor allem eine Sache von Menschen, die es sich entweder leisten können oder die sich in einer juristischen Notlage befinden. Das Recht ist aber nicht nur für solche Fälle da, weshalb ich es gut finde, wenn es mit Hilfe von Legal Tech-Innovationen möglich ist, sich auch um kleinere Belange zu kümmern, die sonst unter den Tisch fallen würden. Zum Beispiel, wie im Fall Flightright, um die Rechte, die ich als Flugpassagierin habe.
Demokratisiert sich dadurch das Recht?
Ich glaube, so kann man das sagen, ja. Zumindest überwindet man das bislang rational begründete Desinteresse von Verbraucher*innen. Gedanken wie „das wird doch sowieso nichts“ oder „wer weiß, wie viel mich das am Ende kostet“ verlieren an Bedeutung. Und das kommt einer Gesellschaft zugute, in der die allermeisten Menschen rechtliche Ansprüche besitzen, die sie bislang nie geltend gemacht haben.
Zum Unternehmen
Alisha Andert definiert „Design Thinking“ als Ansatz, alle Lösungen aus der Perspektive der Nutzenden zu denken. Kern der Arbeit der von ihr mitgegründeten Agentur ist es, den Rechtsmarkt bei dieser Neuausrichtung auf Kund*innen (die sprachlich die Mandant*innen ersetzen) zu unterstützen. Zu den Services zählen das Produkt- und Kommunikationsdesign für Rechtsdienstleistungen sowie Trainings und Workshops für Kanzleien oder Rechtsabteilungen. Das Team der Agentur mit Sitz in Berlin besteht aus acht Juristinnen und einem Juristen, dem Co-Gründer Joaquín Santuber.
www.thisislegaldesign.com
 Ein Forschungsteam am Institut für Allgemeinen Maschinenbau der TH Köln entwickelt derzeit ein innovatives rohstoffliches Verwertungskonzept für Fahrrad-Altreifen im Sinne einer geschlossenen Kreislaufwirtschaft. Ihr Ziel: aus Altreifen neue Fahrradreifen machen. Alte Fahrradreifen landen derzeit in Deutschland in Müllverbrennungsanlagen und werden in Form von Verbrennungsasche deponiert. Im Recycling-Prozess soll die sogenannte Pyrolyse zum Einsatz kommen. Durch Hitzebehandlung werden dabei chemische Verbindungen unter Luftausschluss in die Bestandteile Pyrolysegas, -öl und -koks zerlegt. Das Öl lässt sich zu wertvollen Feinchemikalien für die chemische Industrie weiterverarbeiten. Das Koks soll in die neuen Fahrradreifenmischungen eingebracht werden und fossil hergestellten Industrieruß ersetzen.
Ein Forschungsteam am Institut für Allgemeinen Maschinenbau der TH Köln entwickelt derzeit ein innovatives rohstoffliches Verwertungskonzept für Fahrrad-Altreifen im Sinne einer geschlossenen Kreislaufwirtschaft. Ihr Ziel: aus Altreifen neue Fahrradreifen machen. Alte Fahrradreifen landen derzeit in Deutschland in Müllverbrennungsanlagen und werden in Form von Verbrennungsasche deponiert. Im Recycling-Prozess soll die sogenannte Pyrolyse zum Einsatz kommen. Durch Hitzebehandlung werden dabei chemische Verbindungen unter Luftausschluss in die Bestandteile Pyrolysegas, -öl und -koks zerlegt. Das Öl lässt sich zu wertvollen Feinchemikalien für die chemische Industrie weiterverarbeiten. Das Koks soll in die neuen Fahrradreifenmischungen eingebracht werden und fossil hergestellten Industrieruß ersetzen.

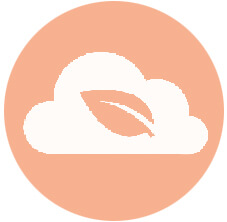




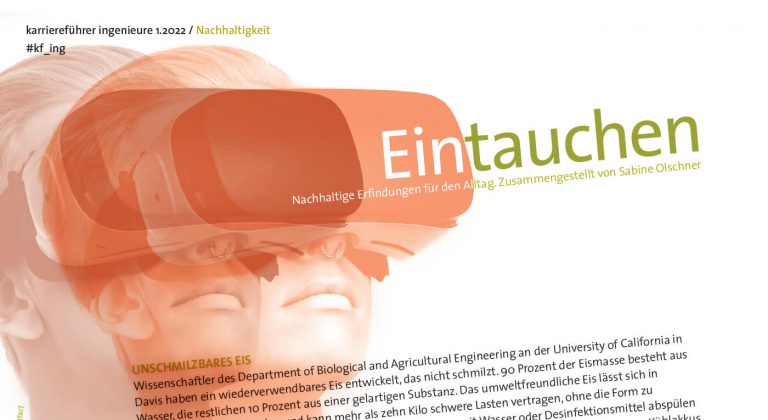
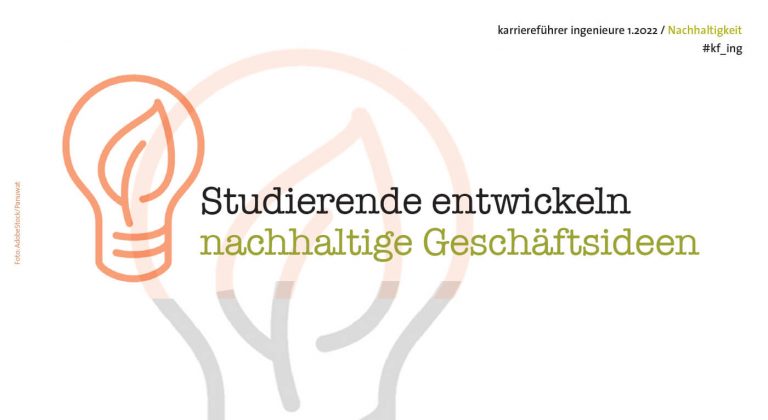

 Der Zugang zu Mobilität hat nachweislich einen großen Einfluss auf den individuellen wirtschaftlichen Erfolg: Wer mobil ist, findet leichter einen Arbeitsplatz, verdient mehr und ist zufriedener. Unser aktuelles Mobilitätsverhalten führt allerdings zu großen Belastungen von Umwelt und Infrastruktur mit negativen Auswirkungen auf die Lebensqualität. Die Autoren Andreas Herrmann, Professor an der Universität St. Gallen, Frank Huber, Professor an der Universität Mainz, und Johann Jungwirth, Ingenieur und Manager in der Automobilindustrie, entwickeln in ihrem Buch praktikable Wege, Mobilität klimagerecht umzugestalten. Sie berichten von revolutionären Geschäftsmodellen neuer Player auf dem Mobilitätsmarkt. Sie vermuten: Das Auto als Lieblingsspielzeug der Deutschen wird bald zum Auslaufmodell. Stattdessen wird Mobilität in Zukunft mehr und mehr zu einem Service, der sich bei Bedarf auf Knopfdruck buchen lässt. Andreas Herrmann, Frank Huber, Johann Jungwirth: Mobilität für alle … auf Knopfdruck. Campus Verlag 2022. 32 Euro
Der Zugang zu Mobilität hat nachweislich einen großen Einfluss auf den individuellen wirtschaftlichen Erfolg: Wer mobil ist, findet leichter einen Arbeitsplatz, verdient mehr und ist zufriedener. Unser aktuelles Mobilitätsverhalten führt allerdings zu großen Belastungen von Umwelt und Infrastruktur mit negativen Auswirkungen auf die Lebensqualität. Die Autoren Andreas Herrmann, Professor an der Universität St. Gallen, Frank Huber, Professor an der Universität Mainz, und Johann Jungwirth, Ingenieur und Manager in der Automobilindustrie, entwickeln in ihrem Buch praktikable Wege, Mobilität klimagerecht umzugestalten. Sie berichten von revolutionären Geschäftsmodellen neuer Player auf dem Mobilitätsmarkt. Sie vermuten: Das Auto als Lieblingsspielzeug der Deutschen wird bald zum Auslaufmodell. Stattdessen wird Mobilität in Zukunft mehr und mehr zu einem Service, der sich bei Bedarf auf Knopfdruck buchen lässt. Andreas Herrmann, Frank Huber, Johann Jungwirth: Mobilität für alle … auf Knopfdruck. Campus Verlag 2022. 32 Euro





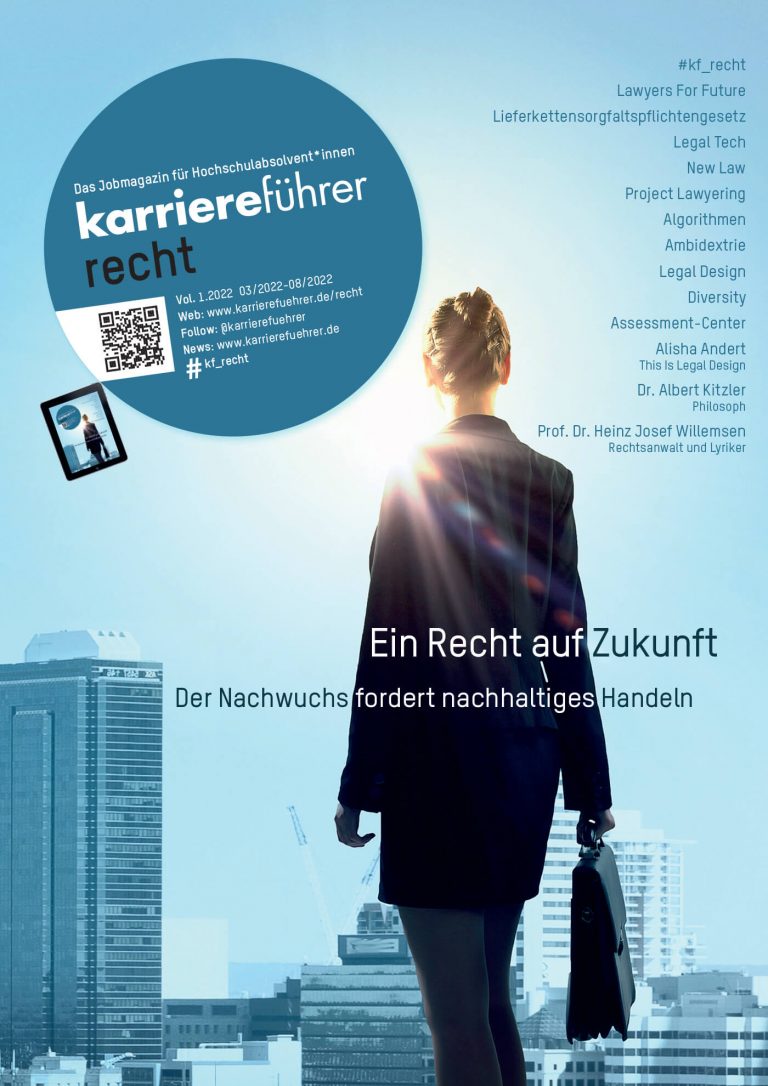


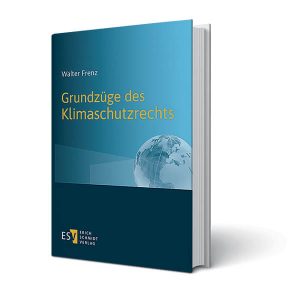 Das Klimaschutzrecht ist elementar für den Bestand der gesamten menschlichen Zivilisation und bildet ein komplexes Mehrebenenrecht. Vor diesem Hintergrund erfasst das Buch „Grundzüge des Klimaschutzrechts“ die wichtigsten Einzelfragen zum brisanten und zukunftsrelevanten Rechtsgebiet – in einem umfassenden Bild, das alle rechtlichen Ebenen berücksichtigt und diese zueinander in Bezug setzt. Betrachtet wird dabei die internationale, europäische und nationale Ebene. Zudem finden wegen ihres konkreten Einflusses auf den Klimaschutz und ihrer nachhaltigen Auswirkungen auf Gesellschaft und Recht noch zwei weitere Topthemen mit globaler Tragweite besondere Beachtung: die Digitalisierung und die Corona-Krise. Prof. Dr. jur. Walter Frenz: Grundzüge des Klimaschutzrechts. Erich Schmidt Verlag 2021, 39 Euro.
Das Klimaschutzrecht ist elementar für den Bestand der gesamten menschlichen Zivilisation und bildet ein komplexes Mehrebenenrecht. Vor diesem Hintergrund erfasst das Buch „Grundzüge des Klimaschutzrechts“ die wichtigsten Einzelfragen zum brisanten und zukunftsrelevanten Rechtsgebiet – in einem umfassenden Bild, das alle rechtlichen Ebenen berücksichtigt und diese zueinander in Bezug setzt. Betrachtet wird dabei die internationale, europäische und nationale Ebene. Zudem finden wegen ihres konkreten Einflusses auf den Klimaschutz und ihrer nachhaltigen Auswirkungen auf Gesellschaft und Recht noch zwei weitere Topthemen mit globaler Tragweite besondere Beachtung: die Digitalisierung und die Corona-Krise. Prof. Dr. jur. Walter Frenz: Grundzüge des Klimaschutzrechts. Erich Schmidt Verlag 2021, 39 Euro.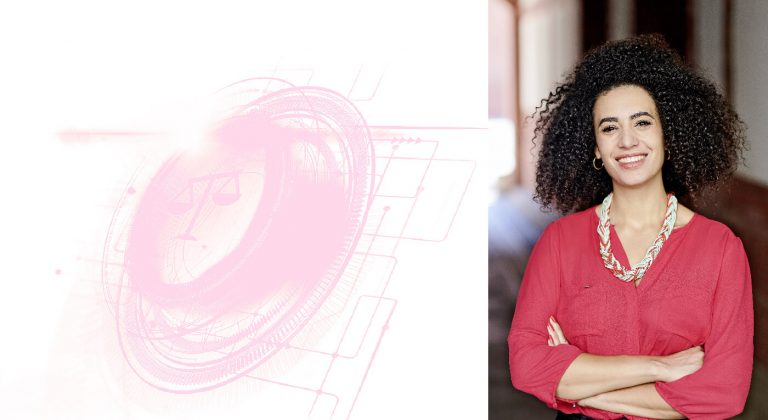



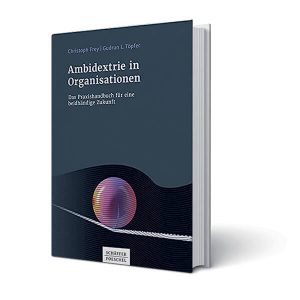 Christoph Frey, Gudrun L. Töpfer: Ambidextrie in Organisationen. Schäffer-Poeschel 2021, 34,95 Euro
Christoph Frey, Gudrun L. Töpfer: Ambidextrie in Organisationen. Schäffer-Poeschel 2021, 34,95 Euro

