Anwält*innen sind gefragt als Anker in der Not, als juristische Ratgeber bei komplexen Fragen und Ruhepol selbst in brisanten Situationen. Hinzu kommen die Herausforderungen der digitalen Transformation, die das juristische Arbeiten sowie den Rechtsmarkt stark verändern. Damit das funktionieren kann, fordert die Branche einen Wandel: Mehr Freiheit durch neue Honorarmodelle, mentale Probleme raus aus der Tabuzone. Das Ziel: den Menschen hinter dem Anwaltsberuf als Ganzes zu betrachten. Damit er, im Sinne des Mandaten, seine beste Leistung abrufen kann. Ein Essay von André Boße
Im März dieses Jahres gründete sich ein neuer Verband für Jurist*innen: Der Bundesverband der Wirtschaftskanzleien (BDW) ist ein Zusammenschluss von derzeit 37 größeren deutschen Kanzleien, verbunden durch das Ziel, sich „gemeinsam für die fachlichen, strategischen und zukunftsorientierten Themen dieses wichtigen Segments des Rechtsmarkts in Deutschland einzusetzen“, wie es auf der BDW-Homepage heißt. Wie groß die Marktposition der beteiligten Kanzleien ist, zeigen ein paar Zahlen: Die Mitglieder des BWD erzielen zusammen pro Jahr mehr als zwei Milliarden Euro Umsatz, wichtige Arbeitgeber für Jurist*innen sind die Mitgliedskanzleien auch, insgesamt sind dort rund 5000 Anwält*innen tätig. Ein interessanter Teil der Struktur des Verbandes ist das Advisory Board, dem laut BDW-Homepage führende Jurst*innen angehören, die in Unternehmen angestellt sind: „So stellen wir sicher, dass der BWD immer auch den Blickwinkel der Mandanten berücksichtigt.“
Mehr Freiheit durch Erfolgshonorare
Wie aber ergibt sich dieser „Blickwinkel der Mandanten“ konkret? Der BDW hat gleich zu Beginn seiner Arbeit eine Reihe von Task Forces ins Leben gerufen, die anzeigen, welche Änderungsprozesse die Wirtschaftskanzleien anstoßen wollen. Ein interessanter Punkt ist zum Beispiel der Bereich der „Erfolgshonorare“: Viele Jahre lang war es Rechtsantwält*innen in Deutschland untersagt, Erfolgshonorare zu vereinbaren. Seit dem 1.10.2021 sind diese nun bei Streitwerten von bis zu 2000 Euro erlaubt – Auslöser dieser kleinen Reform ist die steigende Zahl von Legal-Tech-Unternehmen wie Flighright, die dank digitaler Methoden eine Vielzahl von kleinen, fast gleichgelagerten Fällen bearbeiten – und Kunden über risikolose Erfolgshonorare gewinnen.
Lawyer Wellbeing: Studienergebnisse
Von den vom Liquid Legal Institute für die Studie befragten Antwält*innen berichteten fast 70 Prozent, dass sie in ihrem Berufsleben schon einmal unter von ihrem Beruf verursachten mentalen Problem gelitten hätten. Mehr als 80 Prozent bestätigten, Kolleg*innen zu kennen, die unter mentalen Problemen leiden. Was dagegen nach Ausage der Studienteilnehmer größtenteils fehle, sei eine Hilfsstruktur: Rund 70 Prozent der Befragten gaben an, dass es für sie selbst oder die Kolleg*innen keine Hilfe gegeben habe und das auch kein Frühwarnsystem existiere, das Möglichkeiten aufzeigt, mentale Krisen früh zu erkennen. Eine große Mehrheit der Befragten stimmte zu, dass mentale Probleme nicht nur dazu führten, dass die anwaltliche Performance leide, sondern auch die Führungsqualitäten verringere. Die Studie „Lawyer-Wellbeing – The Silent Pandemic“ steht im Internet kostenlos zur Verfügung.
Der BDW fordert nun, die Idee der Erfolgshonorare weiterzudenken. Geleitet wird die Task Force von Volker Römermann, Honorarprofessor an der Humboldt-Universität Berlin und Vorstand der Wirtschaftskanzlei Römermann. „Wenn wir als junge Anwältinnen und Anwälte aus dem Studium kommen, dann glauben wir, dass wir in diesem Beruf eine Dienstleistung vollbringen. Dann crashen wir in die Wirklichkeit, und es kommen real existierende Mandanten, die fragen: ‚Was ist eigentlich dein Erfolg?‘ Daran messen sie uns, danach wollen sie uns bezahlen“, sagt Volker Römermann in einem Video- Clip, in dem er das Thema seiner Task Force vorstellt. Das Ziel dieser Untergruppe: eine erfolgsbezogene Vergütung für anwaltliche Tätigkeiten einzuführen – ein Bezahlmodell also, das für die Mandanten der Wirtschaftskanzleien im unternehmerischen Alltag längst Selbstverständlichkeit ist. „Wir müssen hier dem Bedarf und dem Interesse der Mandanten gerecht werden, wir brauchen da mehr Freiheit“, fordert Volker Römermann in seinem Statement.
Neue Position im Markt
Unternehmerisches Denken bei Anwält*innen zählt schon lange zu den zentralen Skills in Wirtschaftskanzleien. Nun sollen weitere Schritte folgen, sie betreffen – wie das Thema Erfolgshonorar zeigt – nun auch die Rahmenbedingungen und Strukturen, in denen die Jurist*innen tätig sind. Das ist unbedingt sinnvoll, denn jede Struktur beeinflusst das Handeln. Mit einer Erfolgshonorierung würde die Arbeit der Wirtschaftsanwält*innen ein gutes Stück weiter in den freien Markt rücken. Erkennbar ist dieser Trend schon jetzt, mit der Folge, dass Skills und Themen auf die Agenda rücken, die bislang in juristischen Tätigkeitsfeldern kaum auf dem Radar stehen und daher an den Universitäten häufig nicht genügend vermittelt werden. Was nicht heißt, dass sie nicht von großer Bedeutung sind. Jedoch wurde kaum über sie diskutiert. Und genau das ändert sich jetzt: Der Job der Jurist*innen in Wirtschaftskanzleien wird nun ganzheitlicher betrachtet.
Mentale Probleme eine stille Pandemie?
Der BDW hat eine weitere Task-Force zu einem Bereich gegründet, den man mit in einer Liste der zentralen Ziele eines erfolgsorientierten Verbands von Wirtschaftskanzleien nicht unbedingt erwartet: Lawyer Wellbeing. Impulsgeber, sich als Verband eingehend mit dem Wohlergehen der Anwaltschaft zu beschäftigen, ist die Studie „Lawyer Wellbeing – The Silent Pandemic“, die in diesem Jahr federführend vom Liquid Legal Institute erstellt wurde, einer interdisziplinären Plattform, der sich für ein neues Denken im Rechtsbereich engagiert. Mentale Probleme bei in Wirtschaftskanzleien tätigen Jurist*innen? „Bist du verrückt – Mental Health ist doch bei Jurist*innen kein Thema!“ – so, oder ähnlich sei häufig die Reaktion gewesen, als die Autoren der Studie ihr Thema benannten. „Mit dieser Haltung steht die Profession nicht allein da. Es ist eine natürliche spontane Reaktion auf die Frage zu einem oft tabuisierten Thema, die einen sehr sensiblen Lebensbereich von hochausgebildeten Expert*innen berührt“, heißt es im White Paper der Studie, das die Studienautor*innen im März 2022 im Magazin „Legal Tech Times“ der Legal-Tech-Plattform Future-Law veröffentlichten. Mentaler Stress ergebe sich für Jurist*innen in vielen Fällen bereits im Studium: „Selbstdisziplin ist die Kompetenz der Stunde“, so die Autor*innen. Häufig sei man als Einzelkämpfer* in unterwegs, der Druck, eine exzellente Note im Examen zu erzielen, sei allgegenwärtig, da diese „unwiderruflich über die weitere berufliche Zukunft entscheidet“.
BDW: Verband mit Leitbild
Der Bundesverband der Wirtschaftskanzleien in Deutschland (BDW) hat sich bei der Gründung im Frühling 2022 ein Leitbild gegeben, das einige bemerkenswerte Aspekte beinhaltet. So stehe er für eine „vielfältige, regelbasierte, weltoffene, verantwortungsbewusste, tolerante und demokratische Zivilgesellschaft und für eine lebendige und leistungsfähige Rechtsstaatlichkeit“ ein. Außerdem beachtet er die „Grundsätze der Diversität“ und betrachtet die nachhaltigen ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) als wesentlichen Bestandteil sowie Richtschnur des Verhaltens. In diesem Sinne positioniert sich der BDW nicht als Lobby-Verband, sondern als gesellschaftlicher Player.
Ist die Ausbildung schließlich geschafft, bleibe vom gelernten juristischen Arbeiten, also dem Ansatz, rechtliche Probleme zu erkennen und Lösungen vorzuschlagen, nicht mehr viel übrig. Nun würde der Nachwuchs darauf getrimmt, „auch unter Hochdruck einen ‚kühlen Kopf‘ zu bewahren, Mandanten in kritischen Fragestellungen – zunächst einmal – das Gefühl von Sicherheit zu geben, bei Verhandlungen das Poker Face aufzusetzen und – falls erforderlich – auch mal gegen den eigenen moralischen Kompass zu agieren“, heißt es in der Studie. Jurist*innen sollten also immer einen Ausweg sehen, jederzeit als Ratgeber*in ansprechbar sein und als „Fels in der Brandung zur Verfügung stehen, um Mandant*innen sicher und natürlich möglichst unversehrt durch den juristischen Dschungel zu geleiten, oft in prekären Situationen.“
Digitalisierung kann Stress steigern
Hinzu komme seit einigen Jahren nun noch der Druck sowie die Unsicherheit, die mit der Digitalisierung einhergehen: Steigender Kommunikationsaufwand, gigantische Mengen an Dokumenten und Daten, die von häufig genug veralteten IT-Systemen kaum zu bewältigen seien, dazu Themen wie Cyber-Sicherheit und Datenschutz: „Die Digitalisierung ist ein Brandbeschleuniger für die Verschlechterung des Gesundheitszustands“, heißt es in der Studie. Für eigene Ängste, Schwächen, Zweifel, Unsicherheiten bleibe da wenig Raum. Mehr noch: Alle diese Aspekte würden weiterhin tabuisiert. Doch das müsse aufhören, so die Forderung der Studienautor*innen. Schließlich gehe es um „nicht weniger als um den Menschen hinter der Rolle ‚Jurist*in‘ und seine Position in der modernen Arbeitswelt.“
Für eigene Ängste, Schwächen, Zweifel, Unsicherheiten bleibt wenig Raum. Mehr noch: Alle diese Aspekte werden weiterhin tabuisiert.
Wer nun auch weiterhin denkt, das Thema Wellbeing dürfe in der harten Arbeitsrealität keine Rolle spielen, schließlich wisse man als Nachwuchs, in welche Branche man sich begebe, und obendrein sei der Job gut bezahlt, der verkennt die Rolle, die Anwält*innen heute zu erfüllen haben. In seinem Vorwort zur Studie erklärt der Lebenskrisen-Berater Fritjof Nelting, warum es für ihn als Mandanten kein gutes Zeichen sei, wenn sein Anwalt ihm per Mail eine automatische Benachrichtigung mitsamt Entschuldigung schickt: Er sei im Urlaub, sodass es rund zwei Stunden dauern könnte, bis er Zeit für die Antwort habe. „Anwält*innen besitzen in dieser Gesellschaft eine exponierte und wichtige Position“, schreibt Nelting. „Damit sie ihre Arbeit auf gesunde Weise machen und vielleicht sogar Vorbilder für ein modernes und gut ausbalanciertes Leben werden, sind einige Änderungen notwendig.“ Das sei nicht nur im Sinne der Jurist*innen, sondern auch der Mandanten: „Ein gesunder Anwalt sei das Beste, was einem Mandanten passieren kann“ – und gerade in dieser Zeit, in der es wichtiger denn je sei, „einen resilienten und stabilen Anwalt an der Seite zu haben“.
Schlüsseljob in Kanzleien: Legal Hybrid
Die international tätige Consulting-Gruppe Henchman aus Belgien berät Anwält*innen und Kanzleien auf dem Weg, die anwaltliche Arbeit neu zu denken. Digitalisierung ist hier ein Kernthema. Im Henchman-Report „The must have legal tech stack of 2022“ geben Expert*innen Prognosen über die juristische Arbeit der Zukunft ab. In einem Beitrag skizziert der Legal-Tech-Berater Thomas Aertgeerts einige Schlüsselstellen in den Kanzleien der nahen Zukunft. Besonders interessant ist die Postion des „Legal Hybrid“: „Keine Technologie, sondern eine Person. Jemand, der die Bedürfnisse von Kanzleien erkennt und die notwenige Technologie anstößt, damit diese erfüllt werden kann. Ohne eine Person mit diesen Skills ist die jeweilige Kanzlei von der Gnade der Software-Entwickler abhängig.“ Sprich: Der „Legal Hybrid“ sorgt dafür, dass Wirtschaftskanzleien die digitale Transformation mit Aufwind bewältigen.










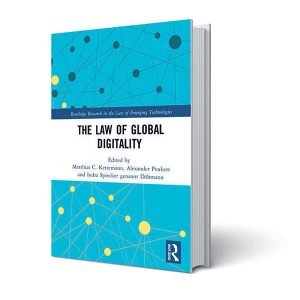





 Fabian Michl:
Wiltraut Rupp-von Brünneck (1912–1977). Campus 2022, 39 Euro
Fabian Michl:
Wiltraut Rupp-von Brünneck (1912–1977). Campus 2022, 39 Euro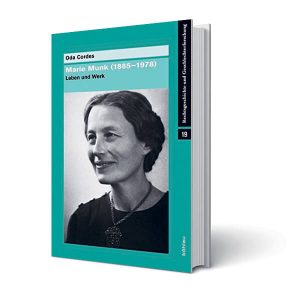 Oda Cordes:
Marie Munk (1885–1978). Böhlau 2015, 12o Euro
Oda Cordes:
Marie Munk (1885–1978). Böhlau 2015, 12o Euro Oda Cordes:
Frauen als Wegbereiter des Rechts: Die ersten deutschen Juristinnen und ihre Reformforderungen in der Weimarer Republik. Diplomica 2012, 29,50 Euro
Oda Cordes:
Frauen als Wegbereiter des Rechts: Die ersten deutschen Juristinnen und ihre Reformforderungen in der Weimarer Republik. Diplomica 2012, 29,50 Euro