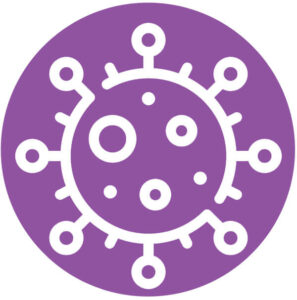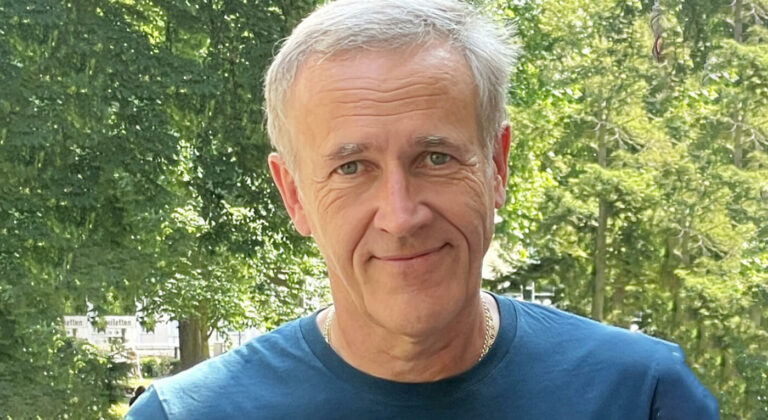Jens Kleinefeld ist Facharzt für Anästhesie-, Intensiv- und Notfallmedizin. Nach vielen Jahren in der Notfallmedizin fokussiert er sich seit 2010 auf Einsätze im Sportbereich: Für Verbände macht er die Dopingkontrollen – auch bei der WM in Katar wird er im Einsatz sein. Und bei Großveranstaltungen ist er als Medical Officer im Notfall für den Rettungseinsatz verantwortlich. Zu einem solchen kam es bei der Fußball- EM 2021: Der dänische Spieler Christian Eriksen kollabierte nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand, Jens Kleinefeld rettete ihm das Leben, vor den Augen von Millionen Zuschauern. Die Fragen stellte André Boße.
Zur Person
Jens Kleinefeld (geboren 1963 in Düsseldorf) ist Facharzt für Anästhesie-, Intensiv- und Notfallmedizin. Bis 2010 war er ärztlicher Leiter im Rettungsdienst der Stadt Solingen, Ausbilder und Prüfer an der staatlichen Rettungsassistentenschule sowie leitender Notarzt der Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal. Seit Mitte der 1990er-Jahre ist er als Doping Control Officer (DCO) und Medical Officer für verschiedenste nationale und internationale Sportverbände aktiv. Als DCO verfügt er über den weltweit höchsten Erfahrungsschatz bei Dopingkontrollen im Fußballsport und wurde 2014 für diese Tätigkeit geehrt. Als Medical Officer war er an der Organisation der Medizinischen Versorgung diverser internationaler sportlicher Großveranstaltungen beteiligt. Als Mitglied der Anti Doping Expert Group eines großen internationalen Sportverbandes arbeitet er an der Weiterentwicklung und Verbesserung der Dopingkontrollsysteme.
Herr Kleinefeld, wie sind Sie als Mediziner in den Bereich des Sports gekommen?
Ich war selbst im Schwimmsport aktiv und habe eines Tages die Anfrage bekommen, ob ich beim Deutschen Schwimmverband bei den Dopingkontrollen mitarbeiten wolle. Das habe ich gemacht, später auch für den Kanuverband. Anfang der 1990er-Jahre sprach mich dann der Deutsche Fußball-Bund an, ob ich mir diese Arbeit auch im deutschen Profifußball vorstellen könne. Es gab damals noch nicht viele Mediziner beim DFB, das Doping-Kontrollsystem stand noch am Anfang, sodass ich dank meiner Erfahrungen recht schnell zum Leading-DCO wurde, also zum führenden Doping-Kontrolleur beim DFB. Über ein Engagement bei der UEFA hat mich dann nach der WM in Deutschland 2006 die FIFA angeheuert, seitdem führe ich die Doping-Kontrollen auch bei internationalen Länderspielen im Auftrag des Weltverbands durch, mittlerweile als freier Dienstleister der Nationalen Anti-Doping- Agentur NADA.
Als Sie diese Karriere starteten, kam das Thema Doping gerade frisch auf die Agenda.
Das stimmt, in den Fokus rückte es insbesondere nach der Wiedervereinigung, als die früher getrennten deutschen Teams aus Ost und West erstmals gemeinsam auftraten und die Doping-Vergangenheit in der DDR in aller Munde war. Gerade im Schwimmsport war das eine interessante Zeit.
Hat man Sie damals als Störenfried betrachtet?
Man muss halt schauen, wie man auftritt. Wenn man den Athleten vermittelt, dass man die Sportart sauber halten will und die Dopingkontrollen zu deren medizinischem Schutz durchführt, reagieren die allermeisten mit Akzeptanz.
Ich stelle mir vor, dass es in der ersten Zeit noch recht einfach war, Dopingsünder zu überführen. Ist es mittlerweile wie bei der Geschichte vom Hase und dem Igel: Immer, wenn sie einen Weg gefunden haben, Substanzen zu identifzieren, sind die Doper schon einen Schritt weiter?
Solche Verschleierungstaktiken gab es immer schon. Unsere Aufgabe ist es, immer bessere Nachweismethoden zu entwickeln, wobei gerade das Labor an der Sporthochschule Köln führend war, zum Beispiel beim Nachweis von EPO, das das Wachstum von roten Blutkörperchen steigert, im Radsport. Generell glaube ich, dass wir in den Laboren den Dopingsündern mehr auf den Fersen sind, als es früher der Fall war. Wobei sich die Kontrollen an sich nicht geändert haben, es werden auch weiterhin Urinproben genommen, und natürlich muss man aufpassen, dass bei diesem Prozess nicht betrogen wird.
Es ist also detektivischer Spürsinn gefragt.
Genau, man muss genau hingucken, muss beobachten – und hat durchaus das Recht, bestimmte Athleten, bei denen es Auffälligkeiten gibt, auch dann zu kontrollieren, wenn sie nicht dafür ausgelost wurden.
Welche Skills sind darüber hinaus für diesen Job wichtig?
Man sollte schon an Sport interessiert sein, zudem sollte man sich in den Sportarten, bei denen man im Einsatz ist, auskennen, weil es immer Besonderheiten gibt. Es kommt darauf an, den besten Zeitpunkt für die Kontrollen zu erwischen, denn wir wollen sie ja mit unserer Arbeit nicht aus dem Rhythmus bringen.
Manche meinen, Doping sei kein Betrug, wenn alle dopen. Stimmt das?
Nein. Doping ist Betrug. Mehr noch: Doping hat weitreichende Folgen, die weit darüber hinaus gehen, dass ein Athlet dadurch leistungsstärker wird. Das ist ein Thema, das bis in den Kinderund Jugendschutz geht. Junge Menschen beginnen früh damit, sich für den Leistungssport bereit zu machen. Wann also gibt man diesen Mädchen und Jungen zum ersten Mal verbotene leistungssteigernde Substanzen? Mittel, die ja auch deshalb verboten sind, weil sie schädigende Auswirkungen auf den Organismus haben. Man kann Doping daher nicht legalisieren. Im Schwimmsport war es der Fall, dass 14, 15 Jahre alte Mädchen Mittel bekommen hatten, ohne selbst zu wissen, was sie da leichtgläubig nehmen. Die Athletinnen und auch ihre Eltern dachten, es handele sich um Vitamine, dabei waren es anabole Steroide, die gerade in der Pubertät fatale Nebenwirkungen haben können.
Nun sind Sie neben Ihrer Tätigkeit als Dopingkontrolleur auch als Notfallmediziner beim Fußball tätig, und da kam es im Sommer 2021 zu einem dieser „Weißt du noch, wo du warst, als …?“-Momenten: Drittes Spiel der Europameisterschaft, Dänemark gegen Finnland, in Minute 43 bricht der dänische Spieler Christian Eriksen ohne Fremdeinwirkung zusammen: Herzstillstand. Sie waren der Arzt, der ihm mit Thoraxkompressionen sowie einer Defibrillation das Leben gerettet hat. Rein medizinisch kein besonderer Einsatz, oder?
Genau, das war für einen erfahrenen Notfallmediziner wie mich Rettungsroutine.
Eine der Eigenschaften eines Rettungsarztes muss sein: Je kritischer eine Situation ist desto ruhiger muss man sein. Denn die eigene Nervosität würde sich übertragen, was nicht passieren darf.
Nur, dass in diesem Fall fast 40 000 Menschen im Stadion dabei waren und Millionen vor dem Fernseher.
Das muss man unbedingt ausklammern. Eine der Eigenschaften eines Rettungsarztes muss sein: Je kritischer eine Situation ist desto ruhiger muss man sein. Denn die eigene Nervosität würde sich übertragen, was nicht passieren darf. In diesem Fall war ich der Leader einer Reanimation, und natürlich muss man wie in allen Führungspositionen kühlen Kopf bewahren, klare Anweisungen geben und sich nicht von den äußeren Umständen beeinflussen lassen. Mir ist dieses Ausblenden im Fall Eriksen gut gelungen, ich war auf den Notfall fokussiert, hatte die Zuschauer im Stadion oder vor den Bildschirmen nicht auf dem Schirm, sondern habe einfach das getan, was ich kann, was ich gelernt habe. Dafür gibt es kein Coaching, das ist einfach Berufserfahrung.
Und die Rettung hat funktioniert.
Ja, aber das hat mich nicht überrascht, weil ich schon auf dem Weg zum ihm wusste, dass die Geschichte gut ausgehen wird, dass er überlebt. Was wir hier hatten, war ein beobachteter Herz-Kreislauf-Stillstand als Folge eines Rhythmusereignisses. Beobachtet heißt, dass ich quasi direkt bei ihm war, nachdem es passierte. Die Überlebenschancen sind in diesem Fall recht hoch, und natürlich war es ein schönes Ereignis, als er aufwachte …
… und sinngemäß sagte: „Ich bin doch erst 29 Jahre alt.“ Er wusste also, was ihm da passiert war.
Ja, und diese reflektierte Aussage zeigte mir direkt, dass er keine Hirnschäden davongetragen hatte, was wunderbar war. Denn darum geht es bei der Reanimation ja auch: neurologische Schäden zu vermeiden.
Es ist wichtig, die Menschen weiter aufzuklären, dass bereits eine recht simple Herzdruckmassage die Überlebenschancen deutlich erhöht – und dass man dabei gar nicht viel verkehrt machen kann.
Nun passieren die meisten Herz-Kreislauf- Stillstände nicht in Gegenwart eines Arztes.
Das stimmt, bei Notfällen, die ohne ärztliche Beobachtung passieren, vergehen mehre Minuten – wobei in dieser Zeit nur in seltenen Fällen jemand mit den ersten Maßnahmen zur Reanimation beginnt. Viele Leute haben Angst, etwas falsch zu machen. Wobei es der größte Fehler ist, überhaupt nichts zu machen. Daher ist es wichtig, die Menschen weiter aufzuklären, dass bereits eine recht simple Herzdruckmassage die Überlebenschancen deutlich erhöht – und dass man dabei gar nicht viel verkehrt machen kann. Genauso wichtig ist es, möglichst bei allen größeren Sportveranstaltungen Defibrillatoren sowie Leute, die diese Geräte auch bedienen können, zu haben.
Plädieren Sie für eine Aufklärung darüber, was im Notfall zu tun ist?
Absolut, wobei wir erkennen, dass gerade nach einem Ereignis wie dem Zusammenbruch von Eriksen das Interesse seitens der Sportvereine steigt: Immer mehr Clubs, auch aus dem Amateurbereich, kommen zu uns, um sich schulen zu lassen, mittlerweile sind diese Schulungen sogar verpflichtend. Oft muss halt was passieren, bevor es zum Umdenken kommt. Das war bei mir nicht anders, ich habe mich für die Tätigkeit als Medical Officer beim Fußball zu interessieren begonnen, nachdem Mitte der 2000er-Jahre die zwei jungen Spieler Marc-Vivien Foé und Miklós Fehér einen plötzlichen Herztod erlitten, weil man ihnen auf dem Platz nicht schnell und effektiv genug helfen konnte. Mir war klar: Diese Todesfälle sind vermeidbar, also tun wir alles dafür.
Zum Unternehmen
Jens Kleinefeld ist einer von zwei Geschäftsführern der Agentur Sports Medical Services (sms), einem Dienstleister im Dopingkontrollwesen für Sportverbände und Nationale Antidoping Agenturen. Auch engagiert sich das Unternehmen in der Dopingprävention, um bei Trainern und Athleten das Wissen zu vermitteln, dass Doping nicht nur Betrug ist, sondern dem eigenen Organismus schadet. Ein drittes Geschäftsfeld ist das Notfalltraining bei Sportereignissen. Geschult werden Ärzte, Physiotherapeuten und Trainer von Leistungssportlern, um vor Ort schnell und effektiv Notfälle zu erkennen und zu behandeln sowie den Beteiligten die Angst vor Notfallsituationen zu nehmen.

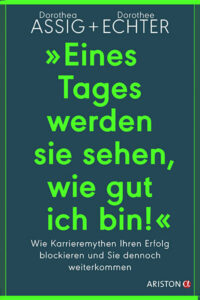 Der Chef ist ein mieser Typ, das Unternehmen rücksichtslos, und für eine Beförderung braucht man das „richtige“ Vitamin B. Ist das wirklich so? Diese und andere Karrieremythen entlarven die Topmanagement-Beraterinnen Dorothea Assig und Dorothee Echter in ihrem neuen Buch „Eines Tages werden sie sehen, wie gut ich bin!“. Sie haben zahlreiche Menschen dabei unterstützt, die Ursachen für ihren Karrierestillstand zu finden. Meistens haben sich kleine Rückschläge zu handfesten Karrieremythen verhärtet. Assig und Echter zeigen in ihrem Buch, wie aus Karrieremythen Karrierestrategien werden. Dorothea Assig und Dorothee Echter: „Eines Tages werden sie sehen, wie gut ich bin!“: Wie Karrieremythen Ihren Erfolg blockieren und Sie dennoch weiterkommen. Ariston Verlag 2022. 20 Euro
Der Chef ist ein mieser Typ, das Unternehmen rücksichtslos, und für eine Beförderung braucht man das „richtige“ Vitamin B. Ist das wirklich so? Diese und andere Karrieremythen entlarven die Topmanagement-Beraterinnen Dorothea Assig und Dorothee Echter in ihrem neuen Buch „Eines Tages werden sie sehen, wie gut ich bin!“. Sie haben zahlreiche Menschen dabei unterstützt, die Ursachen für ihren Karrierestillstand zu finden. Meistens haben sich kleine Rückschläge zu handfesten Karrieremythen verhärtet. Assig und Echter zeigen in ihrem Buch, wie aus Karrieremythen Karrierestrategien werden. Dorothea Assig und Dorothee Echter: „Eines Tages werden sie sehen, wie gut ich bin!“: Wie Karrieremythen Ihren Erfolg blockieren und Sie dennoch weiterkommen. Ariston Verlag 2022. 20 Euro

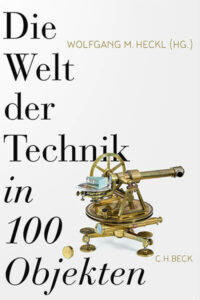 Was uns ein Mikroskop aus dem 17. Jahrhundert über den Aufbruch in eine neue Zeit berichten kann, wie auf der Pariser Weltausstellung von 1900 gezeigte Teerfarbstoffe die Entstehung der modernen Malerei beeinflussten und was eine aus alten Safttüten gefertigte Umhängetasche über das Anthropozän verrät: All das beschreibt der Generaldirektor des Deutschen Museums, Prof. Dr. Wolfgang M. Heckl, in seinem reich bebilderten Buch „Die Welt der Technik in 100 Objekten“. Jedes Objekt wird auf mehreren Ebenen vorgestellt: was zu seiner Erfindung führte; für welche Zeit es geschaffen wurde; wie es die Beziehung des Menschen zur Wirklichkeit und nicht zuletzt diese Wirklichkeit selbst verändert hat; wie sein Lebenslauf aussah und schließlich auch, auf welchen Wegen es in das Deutsche Museum fand. Wolfgang M. Heckl: Die Welt der Technik in 100 Objekten. C.H. Beck Verlag 2022. 39,95 Euro
Was uns ein Mikroskop aus dem 17. Jahrhundert über den Aufbruch in eine neue Zeit berichten kann, wie auf der Pariser Weltausstellung von 1900 gezeigte Teerfarbstoffe die Entstehung der modernen Malerei beeinflussten und was eine aus alten Safttüten gefertigte Umhängetasche über das Anthropozän verrät: All das beschreibt der Generaldirektor des Deutschen Museums, Prof. Dr. Wolfgang M. Heckl, in seinem reich bebilderten Buch „Die Welt der Technik in 100 Objekten“. Jedes Objekt wird auf mehreren Ebenen vorgestellt: was zu seiner Erfindung führte; für welche Zeit es geschaffen wurde; wie es die Beziehung des Menschen zur Wirklichkeit und nicht zuletzt diese Wirklichkeit selbst verändert hat; wie sein Lebenslauf aussah und schließlich auch, auf welchen Wegen es in das Deutsche Museum fand. Wolfgang M. Heckl: Die Welt der Technik in 100 Objekten. C.H. Beck Verlag 2022. 39,95 Euro 











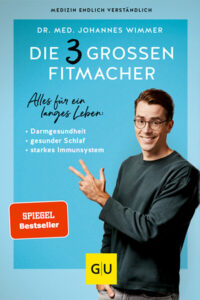 Medizin so erklärt, dass es jeder versteht – das ist das Motto des bekannten NDR-Fernsehmediziners Dr. Johannes Wimmer, dem er auch mit seinem neuen Ratgeber treu bleibt. Dieses Mal geht er drei großen Themen auf die Spur: dem wichtigen Thema „gesunder Schlaf“, dem „Darkroom“ Bauch sowie unserem nicht erst durch Corona in den Fokus geratenen Immunsystem. Woher kommen unsere Schlafprobleme? Wieso sind chronische Erkrankungen so ein großes Thema? Wie kann das Immunsystem auf gesunde Weise geboostert werden? Er erklärt und veranschaulicht auf unterhaltsame Art, wie Krankheiten entstehen, wie man sich dagegen schützt und was man tun kann, wenn man darunter leidet. Dr. med. Johannes Wimmer: Die 3 großen Fitmacher. Warum Darmgesundheit, gesunder Schlaf und ein starkes Immunsystem überlebenswichtig sind. ISBN 978-3-8338-7873-2. 14,99 Euro.
Medizin so erklärt, dass es jeder versteht – das ist das Motto des bekannten NDR-Fernsehmediziners Dr. Johannes Wimmer, dem er auch mit seinem neuen Ratgeber treu bleibt. Dieses Mal geht er drei großen Themen auf die Spur: dem wichtigen Thema „gesunder Schlaf“, dem „Darkroom“ Bauch sowie unserem nicht erst durch Corona in den Fokus geratenen Immunsystem. Woher kommen unsere Schlafprobleme? Wieso sind chronische Erkrankungen so ein großes Thema? Wie kann das Immunsystem auf gesunde Weise geboostert werden? Er erklärt und veranschaulicht auf unterhaltsame Art, wie Krankheiten entstehen, wie man sich dagegen schützt und was man tun kann, wenn man darunter leidet. Dr. med. Johannes Wimmer: Die 3 großen Fitmacher. Warum Darmgesundheit, gesunder Schlaf und ein starkes Immunsystem überlebenswichtig sind. ISBN 978-3-8338-7873-2. 14,99 Euro.
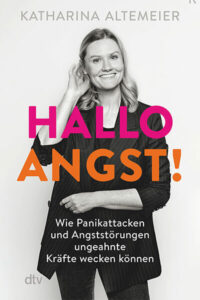 Angststörungen und Panikattacken sind für viele Alltag – der Kampf dagegen ist ermüdend und oft nicht zielführend. Diese Erkenntnis hatte die systemische Beraterin Katharina Altemeier, nachdem sie selbst viele Jahre gegen ihre Angststörung angekämpft hat. Nun weiß sie: Nur wer sich seiner Angst annähert, sie kennenlernt und den mutigen Schritt auf sie zu wagt, wird frei sein. Nur wer stehen bleibt und seiner Angst ins Gesicht blickt, wird zu sich selbst finden. Die Autorin nimmt uns mit und erzählt anhand ihrer persönlichen Erfahrungen, holt Rat bei Experten und gibt uns aus systemischer Sicht Wege und Lösungen mit, wie Leichtigkeit und Leben mit Angst und Panik gelingen. Katharina Altemeier: Hallo Angst! Dtv 2022. ISBN 978-3-423-35166-9. 12 Euro.
Angststörungen und Panikattacken sind für viele Alltag – der Kampf dagegen ist ermüdend und oft nicht zielführend. Diese Erkenntnis hatte die systemische Beraterin Katharina Altemeier, nachdem sie selbst viele Jahre gegen ihre Angststörung angekämpft hat. Nun weiß sie: Nur wer sich seiner Angst annähert, sie kennenlernt und den mutigen Schritt auf sie zu wagt, wird frei sein. Nur wer stehen bleibt und seiner Angst ins Gesicht blickt, wird zu sich selbst finden. Die Autorin nimmt uns mit und erzählt anhand ihrer persönlichen Erfahrungen, holt Rat bei Experten und gibt uns aus systemischer Sicht Wege und Lösungen mit, wie Leichtigkeit und Leben mit Angst und Panik gelingen. Katharina Altemeier: Hallo Angst! Dtv 2022. ISBN 978-3-423-35166-9. 12 Euro.
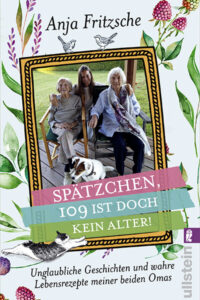 Wer hat schon eine Großmutter von über 100 Jahren? Anja Fritzsche hat gleich zwei: Oma Maria ist 108 und liebt Facebook und das Internet, Oma Mia ist 101 und liebt schnelle Autos und Motorräder – beide sind phänomenal und halten die Familie ständig auf Trab. Außerdem zeigen sie, wie herzerfrischend und heiter das Leben auch im hohen Alter sein kann, zumindest wenn man eine Portion Lebensfreude mitbringt. Enkelin Anja Flieda Fritzsche erzählt mit viel Humor und umwerfendem Charme vom lustigen Alltag mit den beiden – und verrät nebenbei noch Oma Marias beste Kochrezepte. Anja Flieda Fritzsche: Spätzchen, 109 ist doch kein Alter. Ullstein 2022. ISBN 9783548066196. 12,99 Euro.
Wer hat schon eine Großmutter von über 100 Jahren? Anja Fritzsche hat gleich zwei: Oma Maria ist 108 und liebt Facebook und das Internet, Oma Mia ist 101 und liebt schnelle Autos und Motorräder – beide sind phänomenal und halten die Familie ständig auf Trab. Außerdem zeigen sie, wie herzerfrischend und heiter das Leben auch im hohen Alter sein kann, zumindest wenn man eine Portion Lebensfreude mitbringt. Enkelin Anja Flieda Fritzsche erzählt mit viel Humor und umwerfendem Charme vom lustigen Alltag mit den beiden – und verrät nebenbei noch Oma Marias beste Kochrezepte. Anja Flieda Fritzsche: Spätzchen, 109 ist doch kein Alter. Ullstein 2022. ISBN 9783548066196. 12,99 Euro.
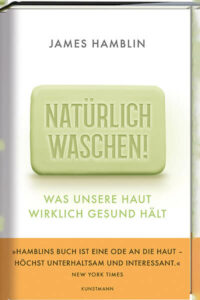 Duschen, Baden, Waschen – die Rituale der Körperpflege sind uns heilig und teuer. Doch die Produkte der milliardenschweren Kosmetikindustrie haben teils gravierende Nebenwirkungen. Anhand neuester Erkenntnisse zeigt James Hamblin, was wir bei der Hautpflege anders machen sollten. Um herauszufinden, wie wir unsere Haut am besten schützen und versorgen, widmet sich Journalist und Arzt James Hamblin der Kulturgeschichte unserer Körperpflege und der Wissenschaft von der Haut. Er spricht mit Mikrobiologen, Allergologen, Genetikern, Ökologen, Kosmetikfachleuten, Seifenfans, Venture-Capital-Unternehmen, Historikern, Entwicklungshelfern, sogar mit ein paar waschechten Betrügern und erfährt, dass sich unsere Vorstellung von sauber und rein gerade grundlegend verändert. Und: Um die Haut und ihr Mikrobiom gesund zu halten, ist weniger oft mehr. James Hamblin: Natürlich waschen! Kunstmann 2021. ISBN 978-3-95614-461-5. 24 Euro.
Duschen, Baden, Waschen – die Rituale der Körperpflege sind uns heilig und teuer. Doch die Produkte der milliardenschweren Kosmetikindustrie haben teils gravierende Nebenwirkungen. Anhand neuester Erkenntnisse zeigt James Hamblin, was wir bei der Hautpflege anders machen sollten. Um herauszufinden, wie wir unsere Haut am besten schützen und versorgen, widmet sich Journalist und Arzt James Hamblin der Kulturgeschichte unserer Körperpflege und der Wissenschaft von der Haut. Er spricht mit Mikrobiologen, Allergologen, Genetikern, Ökologen, Kosmetikfachleuten, Seifenfans, Venture-Capital-Unternehmen, Historikern, Entwicklungshelfern, sogar mit ein paar waschechten Betrügern und erfährt, dass sich unsere Vorstellung von sauber und rein gerade grundlegend verändert. Und: Um die Haut und ihr Mikrobiom gesund zu halten, ist weniger oft mehr. James Hamblin: Natürlich waschen! Kunstmann 2021. ISBN 978-3-95614-461-5. 24 Euro.
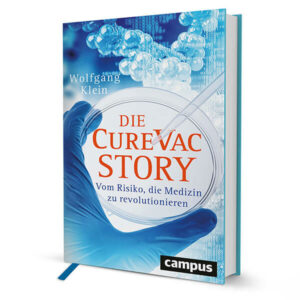 Alles begann mit einer Doktorarbeit und der Entdeckung des medizinischen Potenzials des Botenmoleküls „messenger RNA“. Am Ende stehen prominente Investoren wie Dietmar Hopp oder die Gates-Stiftung, Hunderte Millionen staatlicher Finanzierung, der Aufstieg zum Börsenstar und zum erfolgreichen Impfstoffentwickler. Dazwischen liegt ein steiniger Weg auf der Suche nach Unterstützung. Biotech-Unternehmer Wolfgang Klein hat die Anfangszeit als Finanzchef von CureVac selbst miterlebt. Er erzählt die einzigartige und anekdotenreiche Geschichte auf dem Weg zum Weltunternehmen. Dabei gibt er Einblicke in eine faszinierende Technologie und beschreibt die Hürden für Innovation am Standort Deutschland. CureVac hat es trotzdem geschafft: Die in Tübingen erfundene Technologie ist dabei, die Medizin zu revolutionieren. Wolfgang Klein: Die CureVac-Story. Campus 2021. ISBN 9783593514901. 24,95 Euro.
Alles begann mit einer Doktorarbeit und der Entdeckung des medizinischen Potenzials des Botenmoleküls „messenger RNA“. Am Ende stehen prominente Investoren wie Dietmar Hopp oder die Gates-Stiftung, Hunderte Millionen staatlicher Finanzierung, der Aufstieg zum Börsenstar und zum erfolgreichen Impfstoffentwickler. Dazwischen liegt ein steiniger Weg auf der Suche nach Unterstützung. Biotech-Unternehmer Wolfgang Klein hat die Anfangszeit als Finanzchef von CureVac selbst miterlebt. Er erzählt die einzigartige und anekdotenreiche Geschichte auf dem Weg zum Weltunternehmen. Dabei gibt er Einblicke in eine faszinierende Technologie und beschreibt die Hürden für Innovation am Standort Deutschland. CureVac hat es trotzdem geschafft: Die in Tübingen erfundene Technologie ist dabei, die Medizin zu revolutionieren. Wolfgang Klein: Die CureVac-Story. Campus 2021. ISBN 9783593514901. 24,95 Euro.
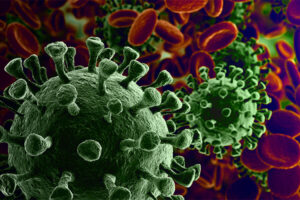
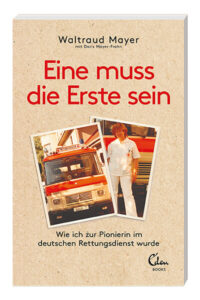 1979 stieg die junge Waltraud Mayer als eine der ersten Frauen in Deutschland in den Rettungsdienst ein. Für sie war das erste Mal am Steuer eines Rettungswagens zwar ein Sprung ins kalte Wasser, doch es fühlte sich an wie ein Sechser im Lotto. Über dreißig Jahre war sie mit dabei: bei Verkehrsunfällen, häuslichen Unglücken und sogar einem Tötungsdelikt, das später prominent verfilmt wurde. In ihrem Buch gibt sie Einblick in den Alltag im Rettungsdienst und erzählt von den Herausforderungen, die sie gemeistert hat. Waltraud Mayer, Doris Mayer-Frohn: Eine muss die Erste sein. Wie ich zur Pionierin im deutschen Rettungsdienst wurde. Eden 2022. 16,95 Euro
1979 stieg die junge Waltraud Mayer als eine der ersten Frauen in Deutschland in den Rettungsdienst ein. Für sie war das erste Mal am Steuer eines Rettungswagens zwar ein Sprung ins kalte Wasser, doch es fühlte sich an wie ein Sechser im Lotto. Über dreißig Jahre war sie mit dabei: bei Verkehrsunfällen, häuslichen Unglücken und sogar einem Tötungsdelikt, das später prominent verfilmt wurde. In ihrem Buch gibt sie Einblick in den Alltag im Rettungsdienst und erzählt von den Herausforderungen, die sie gemeistert hat. Waltraud Mayer, Doris Mayer-Frohn: Eine muss die Erste sein. Wie ich zur Pionierin im deutschen Rettungsdienst wurde. Eden 2022. 16,95 Euro 
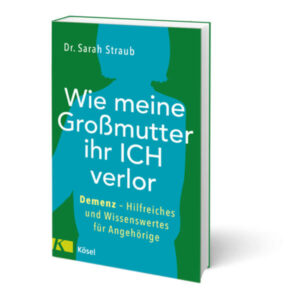 Dr. Sarah Straub: Wie meine Großmutter ihr Ich verlor. Kösel 2021. ISBN 978-3-466-34772-8. 18 Euro.
Dr. Sarah Straub: Wie meine Großmutter ihr Ich verlor. Kösel 2021. ISBN 978-3-466-34772-8. 18 Euro.