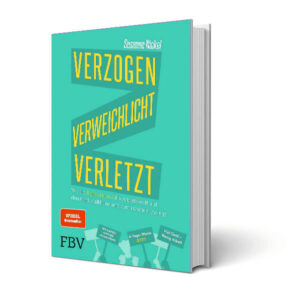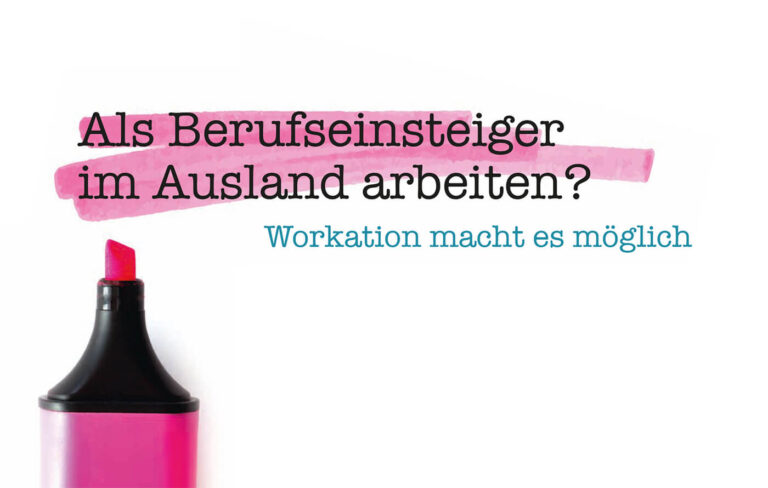In Kanzleien wird die generative KI zum Gegenwartsthema. Large Language Modelle wie ChatGPT-4 unterstützen bei bestimmten anwaltlichen Tätigkeiten. Studien zeigen: Sie sind dabei so gut wie Menschen, aber schneller und kostengünstiger. Dieser Schub an Produktivität ist für Kanzleien notwendig – und gibt Juristinnen und Juristen die Möglichkeit, sich auf die Arbeiten zu fokussieren, bei denen sie wiederum der KI überlegen sind. Mit dem Ziel, eine Partnerschaft zwischen Mensch und Maschine zu etablieren. Ein Essay von André Boße
Die Signale aus dem Rechtsmarkt klingen zunächst widersprüchlich. Einerseits gehen die Akteure davon aus, dass die Bedeutung von Legal-Tech-Anwendungen (also speziell für den Rechtsmarkt konzipierte digitale Tools, zumeist auf KI-Basis) weiter steigen wird, weil sie die Arbeit in Kanzleien effizienter machen. Andererseits bleibt es für Kanzleien eine Hauptaufgabe, Fachkräfte zu rekrutieren. Ein Widerspruch ist das aber eben nicht. Zwar wird der Rechtsmarkt von immer neuen technischen Möglichkeiten geprägt, ausgelöst insbesondere durch Entwicklungen im Bereich der generativen künstlichen Intelligenz. Jedoch ersetzen diese KI-Modelle keine juristischen Fachkräfte – zumindest nicht in den Arbeitsbereichen, in denen es auf echte juristische Expertise ankommt. Weshalb es auch nicht möglich sein wird, den Fachkräftemangel auf dem Rechtsmarkt durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz zu lösen, sondern im besten Fall abzumildern. Was wiederum bedeutet, dass keine Nachwuchskraft Angst haben muss, von einer künstlichen Intelligenz ersetzt zu werden.
Generative KI als Unterstützung
Online Kurse
Wer schnell und effizient seine Kenntnisse in Sachen KI für Juristinnen und Juristen erweitern will, findet im Internetangebot des Legal Tech Verbandes Informationen über Onlinekurse. Neben den Grundlagen der künstlichen Intelligenz erhalten die Teilnehmenden einen Überblick darüber, welche Rolle KI-Tools für den Rechtsmarkt spielen und wie sie sich gezielt im persönlichen Arbeitsalltag einsetzen lassen.
Im Einsatz sind Modelle der generativen KI aktuell vor allem als unterstützende Systeme für die Juristinnen und Juristen. Profitieren werden Kanzleien davon nur dann, wenn sie genügend Fachkräfte an Bord haben, die gewinnbringend mit den digitalen Systemen kooperieren. Die Kanzleiarbeit von morgen? Juristinnen und Juristen und KI-Modelle sind zusammen tätig, als Mensch-Maschine-Team. Wobei diese Partnerschaft dann von Erfolg gekrönt sein wird, wenn sich der Mensch nicht von der Maschine treiben lässt – sondern der Mensch es ist, der mit seinem juristischen Fachwissen und Gespür der generativen KI die richtigen Aufträge gibt.
Die aktuelle Future Ready Lawyer-Studie des Beratungsunternehmens Wolters Kluwer belegt diese Entwicklung mit Zahlen. Seit fünf Jahren werden für den Report weltweit führende Mitarbeiter in Kanzleien oder Rechtsabteilungen befragt. Die neueste Untersuchung zeigt, dass ein Großteil der Befragten von einem wachsenden Einfluss von Systemen mit generativer KI ausgeht. Diese Modelle unterscheiden sich von der „klassischen“ KI, indem sie nicht nur in der Lage sind, vorgegebene Inhalte zu analysieren, sondern auch eigene Inhalte herzustellen.
Der wachsende Einfluss generativer KI auf die Rechtsbranche ist einer der bemerkenswertesten Trends der diesjährigen Studie.
„Der wachsende Einfluss generativer KI auf die Rechtsbranche ist einer der bemerkenswertesten Trends der diesjährigen Studie“, heißt es in der Zusammenfassung der Future Ready Lawyer-Untersuchung. So erwarten 73 Prozent, dass der Umgang mit den KI-Modellen in den kommenden Monaten ein Teil ihrer juristischen Arbeit werden – und damit die Tätigkeit stark beeinflussen wird. Die KI in den Kanzleien ist also kein Zukunfts-, sondern ein Gegenwartsthema. Ihr Einsatz, so die Studie, passiert nicht, weil neue Technik ein „Niceto- have“-Thema ist, das man ausprobieren sollte. Es sei vielmehr ein echter Druck zu spüren, die Systeme einzusetzen, als „ein entscheidendes Kriterium für höhere Leistung im Rechtsmarkt“, wie es in der Zusammenstellung des Reports heißt.
Plus an Produktivität
Dabei setzen die Befragten zwei Hoffnungen in die Arbeit mit generativer KI: Erstens soll sie dabei helfen, in den Kanzleien die Produktivität und Effizienz zu erhöhen. Zweitens soll sie dadurch erreichen, das „Risiko einer Fluktuation von Mandant:innen zu verringern“, so die Studienautorinnen und -autoren. Interessant ist das Ergebnis, dass 87 Prozent der Kräfte in Kanzleien, die bereits heute auf Legal-Tech-Tools setzen, berichteten, die Möglichkeiten der Technologie hätten ihre „tägliche Arbeit verbessert“. Wie zentral der Punkt ist, dass die Modelle mit generativer KI einen menschlichen Partner an ihrer Seite benötigen, zeigt die Bewertung der Herausforderung, Fachkräfte zu finden und zu halten: „81 Prozent aller Studien-Teilnehmer:innen gehen davon aus, dass die Arbeit in Kanzleien und Rechtsabteilungen davon geprägt sein wird, wie gut sie imstande sind, Fachkräfte einzustellen und zu binden“, heißt es in der Zusammenfassung der Future Ready Lawyer-Studie.
LLMs: Plug-and-Work-Unterstützung im Office
Wie aber kann generative KI überhaupt in Kanzleien eingesetzt werden? Ein Thema sind vor allem Large Language Modelle (LLM), das bekannteste unter ihnen ist ChatGPT. Dem Entwickler OpenAI ist es gelungen, das Modell bereits früh in der Breite einzuführen, aktuell läuft die Fassung GPT-4. LLM-Systeme gibt es aber auch von Google (PaLM 2) oder Meta (Llama 2). Das Fraunhofer Institut, das daran beteiligt ist, generative KI-Modelle für die Wirtschaft nutzbar zu machen, definiert die LLMs als „leistungsstarke Modelle, die darauf ausgelegt sind, menschliche Sprache zu verstehen und zu generieren. Sie können Text analysieren und verstehen, kohärente Antworten generieren und sprachbezogene Aufgaben ausfuhren.“
Im Gegensatz zu herkömmlichen Sprachmodellen können LLMs viele Aufgaben ohne zusätzliches Finetuning erfüllen.
Dadurch ermöglichten sie eine natürliche Sprachverarbeitung, mit der Unternehmen und Kanzleien Erkenntnisse aus großen Mengen von Textdaten extrahieren oder ihre Content-Erstellung verbessern können. Der Clou: „Im Gegensatz zu herkömmlichen Sprachmodellen können LLMs viele Aufgaben ohne zusätzliches Finetuning erfüllen.“ Sprich, als Partner an der Seite einer juristischen Fachkraft ist dieses Modell kein Anfänger, sondern bereits mit sehr vielen Kenntnissen ausgestattet. Und gerade das macht die Arbeit mit ihm so effizient: Er ist von Beginn an startklar. Plug-and-Play nennt man das bei Unterhaltungsgeräten. Hier kann man von Plug-and-Work sprechen: Für Kanzleien ist das hochattraktiv, um schnell an Produktivität zuzulegen.
GPT-Jobs: zusammenfassen, recherchieren, umformulieren
Goldman Sachs Studie: Die KI übernimmt 44 Prozent
In einer Studie hat die Research-Abteilung der Investmentbank Goldman Sachs untersucht, in welchen amerikanischen Arbeitsbereichen die generative KI das größte Potenzial besitzt, bestimmte Tätigkeiten komplett zu übernehmen. Ganz oben auf der Liste: Tätigkeiten in der Verwaltung (46 Prozent) sowie im Rechtsbereich (44 Prozent). Gleichzeitig prognostiziert die Studie gerade für diese Bereiche einen Produktionsboom. Tritt dieser ein, hebt die KI das Arbeiten auf dem Rechtsmarkt auf ein neues Level.
Konkret schlägt Dr. Dirk Schrameyer, Leiter des Bereichs Digital Product Management Legal bei Wolters Kluwer in Deutschland, in einem Interview mit dem Fachportal Legal Tech Verzeichnis den Einsatz von LLMs dann vor, wenn es darum geht, gerichtliche Entscheidungen zusammenzufassen und den Inhalt von Urteilen und Beschlüssen zu erfassen. LLMs seien in der Lage, den gesamten Schriftsatz schnell zusammenzufassen – inklusive Sachverhalt und Verfahrensgang. „Dies ermöglicht eine schnelle inhaltliche Bewertung der Entscheidungen und reduziert die Anzahl der Dokumente, die vollständig gelesen werden müssen“, wird Dr. Dirk Schrameyer zitiert. Auf diese Art können in kurzer Zeit genau die relevanten Entscheidungen identifiziert werden, die für einen bestimmten Sachverhalt von Bedeutung sind. Es gehe nicht darum, so Dr. Schrameyer, dass die Juristinnen und Juristen sie nicht mehr lesen sollten. Der entscheidende Punkt sei, dass die LLMs für Zeitersparnis sorgen, indem sie die Entscheidungen identifizierten, die relevant seien.
Weitere Einsatzbereiche von generativer KI in Kanzleien sind Tools, die bestimmte Inhalte juristischer Dokumente direkt mit den betreffenden Rechtsprechungen und Gesetzen in den Datenbanken verbinden. Auch beim Erstellen von Vertragstexten sowie bei der Umformulierung von gesetzlichen Texten – zum Beispiel, um sie für Laien verständlicher zu machen – bietet die generative KI effiziente Unterstützung.
GPT schlägt juristische Aushilfskräfte
Wer noch Zweifel hat, ob LLMs im Dickicht des Kanzleialltags und der juristischen Komplexität auch tatsächlich das halten, was sie versprechen, erhält in ersten Studien Antworten. Das in Neuseeland beheimatete AI Center of Excellence hat untersucht, wie gut LLMs im Vergleich zu menschlichen Hilfskräften darin sind, Vertragstexte auf ihre juristische Stichhaltigkeit zu überprüfen. Mit Bezug auf die amerikanische Anwaltsserie „Better Call Saul“ gaben die Forschenden ihrer Studie die Überschrift „Better Call GPT“. Verglichen wurde die Leistung der generativen KI mit der von Rechtsreferendarinnen und -referendaren oder LPOs, also Legal Process Outsourcers, die von der Kanzlei beauftragt werden, diese Prüfungen zu übernehmen.
Insbesondere bei der Geschwindigkeit der Vertragsprüfung zeigen LLMs einen deutlichen Vorteil aufgrund ihrer Rechenleistung, die es ihnen ermöglicht, Texte viel schneller zu verarbeiten und zu analysieren als menschliche Fachkräfte.
Die Ergebnisse zeigen, dass die LLMs mit Blick auf die rechtlichen Aspekte die Vertragstexte genauso gut bestimmen und bewerten, wie es die menschlichen Prüferinnen und Prüfer tun. „Insbesondere bei der Geschwindigkeit der Vertragsprüfung zeigen LLMs einen deutlichen Vorteil aufgrund ihrer Rechenleistung, die es ihnen ermöglicht, Texte viel schneller zu verarbeiten und zu analysieren als menschliche Fachkräfte. Dieser Vorteil ist ein entscheidender Faktor in Bezug auf die Produktivität und die Durchlaufzeiten bei der Vertragsprüfung“, heißt es in der Zusammenfassung der Studie. LLMs lieferten also genaue Ergebnisse zu einem Bruchteil der Zeit und der Kosten, die für die herkömmliche, von Menschen durchgeführte Prüfung erforderlich sei, bewerten die Studienautorinnen und -autoren das Ergebnis ihrer Untersuchung.
Ist es also doch so, dass die Maschine den Menschen ersetzt? Für bestimmte Dienstleistungen wie zum Beispiel die Überprüfung von Vertragstexten gilt das. Diese Services sind allerdings keine Beispiele für eine Arbeit, bei der es auf juristische Finesse ankommt, die nach anwaltlichem Gespür oder einem empathischen Umgang mit den Mandantinnen und Mandanten und ihren juristischen Problemen verlangt. Überall dort also, wo es auf den Menschen ankommt, wird auch auf dem neuen, verstärkt von generativer KI geprägten Rechtsmarkt eine Form von juristischem Know-how gefragt sein, über das selbst die komplexesten und besttrainierten LLMs nicht verfügen. Und wohl auch nie verfügen werden. Es lohnt sich also gerade für den Nachwuchs, sich früh auf diese nicht ersetzbaren Skills zu fokussieren. Wer hier gut aufgestellt ist, findet auf dem Rechtsmarkt der Zukunft auch weiterhin attraktive Jobs – und darf davon ausgehen, als Nachwuchskraft nicht übermäßig mit langweiliger Routinearbeit behelligt zu werden. Denn genau dafür ist die generative KI ja jetzt da.
Zwei-KI-Prinzip gegen Halluzinationen
Wenn LLMs „halluzinieren“, bedeutet das, sie erfinden falsche Fakten. Weil sie sich verschätzen, ihr Deep-Learning-Programm auf eine falsche Fährte gerutscht ist oder sie den Spruch, dass Reden Silber, aber Schweigen Gold sei, nicht kennen. Gerade im juristischen Bereich sind falsche Pseudo-Fakten fatal. Weshalb die LLM-Entwickler aktuell viel dafür tun, den Modellen das Halluzinieren abzugewöhnen. Zum Beispiel, indem sie eine KI-Prüfschleife implementieren, die einen KI-generierten Text prüft. Nach dem Motto: Zwei KIs sind besser als eine.





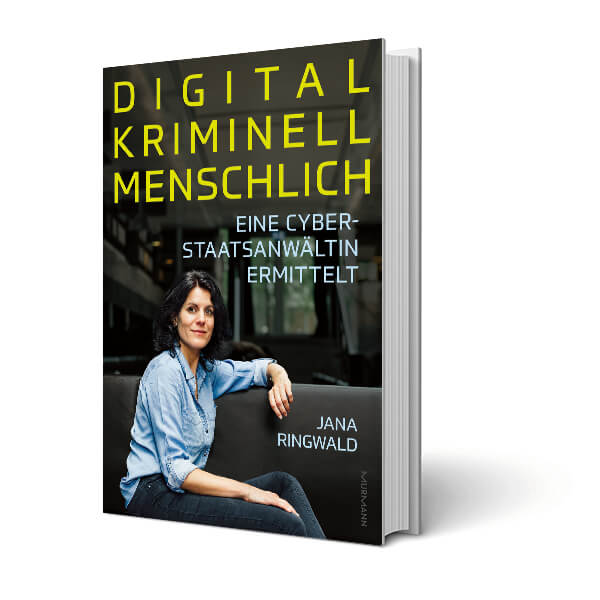 Zum Vertiefen:
Zum Vertiefen: