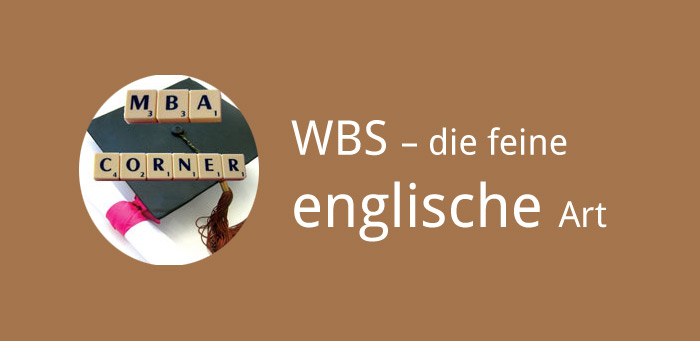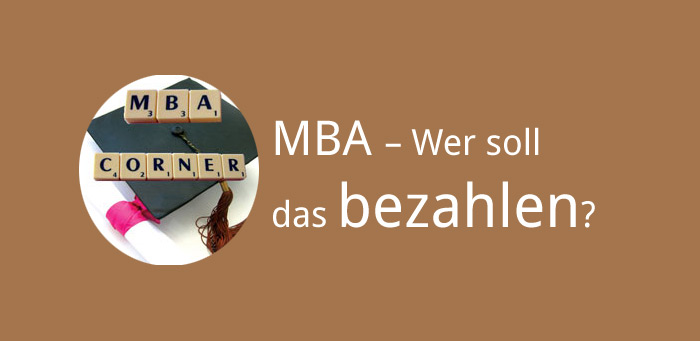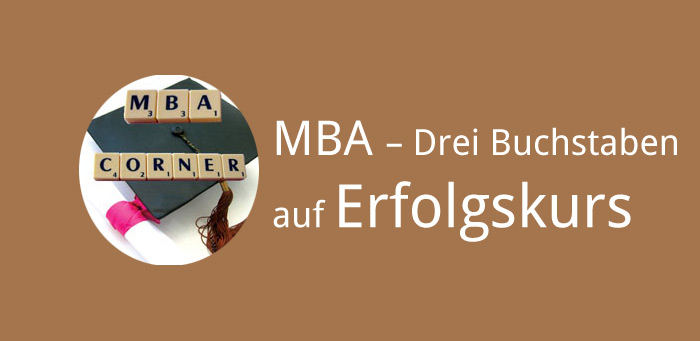Die Weitsichtige. Prof. Dr. Claudia Kemfert ist Forscherin im Spannungsfeld zwischen Ingenieurskunst, Wirtschaft und Umweltschutz. Im Interview erzählt die Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, warum diese drei Bereiche immer mehr zusammenhängen und wie Ingenieure mit Weitblick davon profitieren können. Die Fragen stellte André Boße.
Zur Person Prof. Dr. Claudia Kemfert
Prof. Dr. Claudia Kemfert leitet seit April 2004 die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin), dem größten Wirtschaftsforschungsinstitut Deutschlands mit den Kernaufgaben anwendungsorientierte Wirtschaftsforschung sowie wirtschaftspolitische Beratung. Zudem ist Claudia Kemfert Professorin für Energieökonomie und Nachhaltigkeit an der Hertie School of Governance in Berlin. Sie ist Expertin auf den Gebieten Energieforschung und Klimaschutz.
Claudia Kemfert arbeitete als Beraterin von EU-Präsident José Manuel Barroso und ist Gutachterin des Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC). Sie ist eine mehrfach ausgezeichnete Spitzenforscherin und gefragte Expertin für Politik und Medien. Claudia Kemfert studierte Wirtschaftswissenschaften in Bielefeld und Oldenburg und verbrachte einen Forschungsaufenthalt an der Stanford University in den USA.
Frau Prof. Kemfert, wie darf man Ihren Beruf als Forscherin in verschiedenen Spannungsfeldern beschreiben?
Als Professorin unterrichte ich an der Schnittstelle von Ökonomie, Ökologie und Ingenieurwissenschaften. Ich untersuche die volkswirtschaftlichen Konsequenzen einer nachhaltigen Energieversorgung und Mobilität. Dabei stehen die wirtschaftlichen Aspekte sicherlich im Vordergrund, dennoch spielen Klimaschutz sowie Energie- und Mobilitätstechniken eine ebenso wichtige Rolle. Denn man sollte die technischen Zusammenhänge im Bereich Energie, wie zum Beispiel der Gebäudeenergie oder der Mobilität, einbeziehen, um ökonomische Aussagen treffen zu können.
Wie beurteilen Sie das Verständnis der deutschen Ingenieure für die Bereiche Ökonomie und Ökologie?
In Deutschland und auch in Europa ist das Verständnis insbesondere im Bereich der Ökologie recht hoch. Dennoch reduzieren viele Ingenieure die Ökonomie noch immer auf die Bewertung von Kosten und gesellschaftlicher Akzeptanz. Dabei sind die volkswirtschaftlichen Zusammenhänge durchaus komplexer – denken Sie an energiepolitische Instrumente wie die Förderung erneuerbarer Energien oder den Emissionsrechtehandel. Die Wirkungen betreffen nahezu alle Sektoren einer Volkswirtschaft. Ich beobachte, dass sich Ingenieure vermehrt den Disziplinen Ökonomie und Ökologie öffnen – in Deutschland schon mehr als in anderen Ländern.
Wie groß sehen Sie heute den Bedarf der produzierenden Unternehmen, die Produktion effizienter und klimaneutraler zu gestalten?
Der Bedarf ist enorm. Ob nachhaltige Mobilität, erneuerbare Energien, klimaschonende Antriebstechniken, Ressourcen- und Materialeffizienz, Abfallverwertung oder intelligente Infrastruktur: In keinen anderen Markt werden in den kommenden Jahrzehnten mehr Investitionen fließen als in die zukunftsweisenden Energie- und Mobilitätsmärkte. Die deutsche Wirtschaft kann vom Boom der Branchen enorm profitieren, bis zu eine Million zusätzliche Arbeitsplätze sind möglich. Die Märkte gehören denen, die sie sehen.
Also, gute Chancen für Ingenieure mit ökologischem und ökonomischem Weitblick, oder?
Ja. Ingenieure spielen eine zentrale Rolle, und zwar in allen genannten Bereichen. Sei es in der Montage, dem Anlagenbau, der Installation, oder auch Instandsetzung von Energieanlagen, der Verbesserung der Gebäudeenergie, der Energie- und Biotechnik oder der Fahrzeugtechniken – überall werden jede Menge qualifizierte Ingenieure benötigt.
Wie und wo kann ein Hochschulabsolvent der Ingenieurwissenschaften die Qualifikationen lernen?
Ingenieurstudiengänge sind zwar auch weiterhin sehr fachlich ausgerichtet, mittlerweile bieten aber immer mehr Fachhochschulen und Universitäten eine gezielte Ausrichtung an. Zudem sind auch Schulungs- und Weiterbildungsangebote gestiegen. Dennoch sind es häufig die Unternehmen selbst, die Schulungen anbieten. Daher ist es besonders wichtig, dass die Ausbildung von Bauingenieuren, Ingenieuren mit Energieschwerpunkt sowie Ingenieuren im Bereich Energie- und Biotechnik – wie zum Beispiel Industriemechaniker, Mechatroniker, Fertigmechaniker, Konstruktionsmechaniker, Kunststofftechniker und so weiter – weiterhin verstärkt und ausgebaut wird. Die Jobchancen in diesen Bereichen sind nämlich riesig: Im Jahr 2020 könnte es – bei einem boomenden Weltmarkt – allein im Bereich der erneuerbaren Energien in Deutschland bereits 500.000 Jobs geben.
Warum wird Nachhaltigkeit zwar als Wort gerne verwendet, aber alle Maßnahmen zur Nachhaltigkeit von den Unternehmen werden nicht als Chance, sondern als „Klotz am Bein“ gesehen?
Die weltweite Wirtschaftskrise hat viele Unsicherheiten gebracht, bisher sicher geglaubte Investitionen werden hinterfragt. Dabei sind die Investitionen in Zukunftsmärkte lohnender denn je. Ein jüngstes Ranking von 500 global agierenden Konzernen hat offenbart, dass all jene Konzerne für Kapitalanleger besonders attraktiv sind, die sich der Herausforderung nachhaltiger Energieversorgung und Mobilität erfolgreich stellen. Die ersten vier Plätze belegen übrigens allesamt deutsche Konzerne. Entgegen öffentlicher Behauptungen finden sich unter den ersten vier Plätzen zwei Chemiegiganten, die wichtige Produkte als Ersatz zum Öl oder eine lange Liste von energiesparenden Produkten und Techniken produzieren. Einen besseren Beleg für die Wirtschaftlichkeit eines erfolgreichen Klimaschutzes kann es kaum geben
Sie könnten als Expertin in Ihrem Bereich doch sicherlich sehr schnell in einer hohen Position in ein Unternehmen einsteigen. Was hat Sie bislang davon abgehalten?
Ich bin mit Leib und Seele Wissenschaftlerin. Mich treiben die Neugier und der unglaubliche Spaß an meiner Arbeit an. In meinem Team arbeiten über 15 hochmotivierte Menschen, die ebenso wie ich leidenschaftlich gern forschen. Durch die aktive Politikberatung auf EU- und Bundesebene fließen unsere Forschungsergebnisse in Entscheidungsprozesse ein. Ich erläutere gern einem breiten Publikum die Forschungsergebnisse und versuche, andere für die Forschungsarbeit zu begeistern.
Ein Tipp für angehende Ingenieure, die vor dem Einstieg in die Arbeitswelt stehen: Mit welcher Sicht auf den Begriff Karriere haben Sie gute Erfahrungen gemacht?
Ich halte es wie Konfuzius: „Suche dir einen Beruf, den du liebst – und du brauchst nie in deinem Leben zu arbeiten.“ Es ist ein unglaubliches Geschenk, beruflich das umsetzen zu dürfen, was einem am meisten Freude bereitet.
Wenn Sie an Ihre Pläne aus der Studentenzeit zurückdenken: Haben Sie sich rückblickend selber überrascht – oder halten Sie einen schon damals angedachten Karriereweg ein?
Wie die meisten Wissenschaftler habe ich den Beruf nicht aus Karrieregründen, sondern aufgrund meines großen Forschungsdrangs und Wissensdurstes ergriffen. Wichtig sind neben der Begeisterung für die Sache aber auch Eigenschaften wie Durchhaltevermögen und Gradlinigkeit. Als Hochschullehrerin empfehle ich jedem, das Studienfach zu wählen, das einem wirklich Spaß macht – und nicht das, was die Gesellschaft erwartet.
Begeistern Sie sich eigentlich als Frau auf eine andere Art als Männer für Technik?
Vermutlich schon. Frauen interessieren sich häufig eher für sozialwissenschaftliche als für reine Technikberufe. Dies ändert sich aber glücklicherweise mehr und mehr.
Wie wichtig ist es denn für die Zukunft der deutschen Wirtschaft, dass vermehrt junge Frauen technische Berufe ergreifen und in hohen Positionen arbeiten?
Sehr wichtig! Bei den Themen Energie und Klimaschutz habe ich oft genug allein unter Männern gesessen. Ich erinnere mich an das erste Treffen mit dem EU-Präsidenten Barroso im Rahmen der High Level Expert Group: Ich saß als einzige Frau – blond und zudem unter 40 – unter lauter älteren weißhaarigen Herren. Prompt stand beim anschließenden Mittagessen auf meinem Namensschild „Mr. Kemfert“. Herr Barroso und ich haben herzlich darüber gelacht, er hat mein Schild handschriftlich korrigiert. Und beim nächsten Treffen war nicht nur die Anrede richtig geschrieben, sondern Herr Barroso hatte noch eine weitere Frau in seinen Beraterstab berufen. Daher mein Tipp an alle jungen Frauen, die als Ingenieurinnen Karriere machen möchten: Nur Mut!